|
Geschäftsmodelle
Inhaltsübersicht
I. Begriff und Herkunft
II. Bausteine und Zielelemente
III. Geschäftsmodellinnovationen
I. Begriff und Herkunft
Der Begriff „ Geschäftsmodell “ geht – zumindest im deutschsprachigen Raum – auf die Anfänge der Wirtschaftsinformatik in den 1970er-Jahren zurück und bezeichnet das Ergebnis der sog. Geschäftsmodellierung (vgl. Rentmeister, Jahn/Klein, Stefan 2003). Dabei handelt es sich um die Erfassung und Darstellung von Informationsströmen als Ausgangspunkt einer Modellierung von Geschäftsprozessen und Informationssystemen im Unternehmen. Betriebswirtschaftlich-organisatorisch dient die Geschäftsmodellierung der Effizienzsteigerung: Durch Offenlegung und Dokumentation von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sollen Kommunikationsprozesse erleichtert und das innerbetriebliche Wissensmanagement unterstützt, Ausgangspunkte für eine Optimierung von Abläufen gelegt sowie die notwendigen Voraussetzungen für eine Zertifizierung und betriebsinterne Kostenkalkulation von Geschäftsprozessen geschaffen werden. Informationstechnisch soll damit auch eine Aufwandssenkung im Softwarebereich realisiert werden.
Gegenüber diesem aus der Wirtschaftsinformatik herrührenden Verständnis entstand Ende der 1990er-Jahre ein veränderter, in die Strategische Unternehmensführung hineinpassender Sprachgebrauch, demzufolge ein Geschäftsmodell beschrieben werden kann als „ ? the totality of how a company selects its customers, defines and differentiates its offerings, defines the tasks it will perform itself and those it will outsource, configures its resources, goes to market, creates utility for customers, and captures profit “ (Slywotzky, Adrian 1996, S. 4). Anlass für diesen Sprachgebrauch war zum einen die Entwicklung an den Aktienbörsen und die Gründungseuphorie, die zu einer explosiven Entwicklung von Geschäftsplänen führte, die von Investoren (insbesondere Venture Capital-Gesellschaften) beurteilt werden mussten. Geschäftsmodelle konnten so verstanden werden als vereinfachte Beschreibungen (Modelle!) der Strategie eines gewinnorientierten Unternehmens, die sich dazu eignen, potenziellen Investoren die Sinnhaftigkeit ihres Engagements deutlich zu machen (Knyphausen-Aufseß, Dodo zu/Meinhardt, Yves 2002). Zum anderen kamen mit der Entwicklung des Internet – die ihrerseits eine Ursache für die Börsen- und Gründungseuphorie war – neue Ideen für Geschäftskonzepte auf, die mit der traditionellen Vorstellung des Verkaufs von Produkten und Dienstleistungen wenig zu tun hatten (siehe etwa Timmers, Paul 1998; Mahadevan, B. 2000; Afuah, Allan/Tucci, Christopher 2001; Hummel, Johannes 2002; auch Amit, Raffi/Zott, Christoph 2001). So sollten beispielsweise interessierten Nutzern kostenlose Informationen angeboten werden; das Geld sollte durch die gezielte Einblendung von Werbespots verdient werden (eine Idee, die natürlich ihre Vorläufer hatte, beispielsweise im Bereich von Stadtteilzeitungen). Solche Modelle konnten dann etwa als „ B2C “ (Business to Consumer) leicht klassifiziert und dann auch im Hinblick auf ihr ökonomisches Potenzial beurteilt werden. Ähnlich vereinfachte Beschreibungen entstanden in anderen Branchen, beispielsweise in der Biotechnologie, wo im Wesentlichen zwischen Produktentwicklern und Plattformtechnologieanbietern bzw. Serviceunternehmen (und Hybriden) unterschieden wird (siehe z.B. Casper, Steven 2000), im Mobile Commerce (Clement, Reiner 2002), in der Musik- und Medienindustrie (Zollenkop, Michael 2006; Hass, Berthold 2002) oder auch im Maschinen- und Anlagenbau (Meier, Horst 2004; Bieger, Thomas/Bickhoff, Nils/Caspers, Rolf et al. 2002). Auch die Diskussionen über das Aufkommen von „ Discounter “ -Modellen im Flugverkehr (z.B. Ryanair) und über Allfinanzkonzepte in der Banken- und Versicherungsbranche können in diesen Kontext eingeordnet werden (siehe etwa Bieger, Thomas 2002; Bux, Ulf 2002).
II. Bausteine und Zielelemente
Ein voll entfaltetes Geschäftsmodell beinhaltet drei zusammenwirkende Bausteine und zwei Zielelemente (s. Abb. 1; eine alternative Terminologie findet sich beispielsweise bei Krüger, Wilfried/Bach, Norbert 2001). Attraktiv ist ein Geschäftsmodell für Investoren dann, wenn die Bausteine aufeinander abgestimmt sind – es sich also um eine stimmige Gesamtarchitektur des Geschäftsmodells handelt – , aufgrund der besonderen Gestaltung zumindest eines Bausteines ein deutlicher Kundennutzen erzielt wird und der entstehende Wettbewerbsvorteil gegen die Angriffe der Konkurrenz verteidigt werden kann.
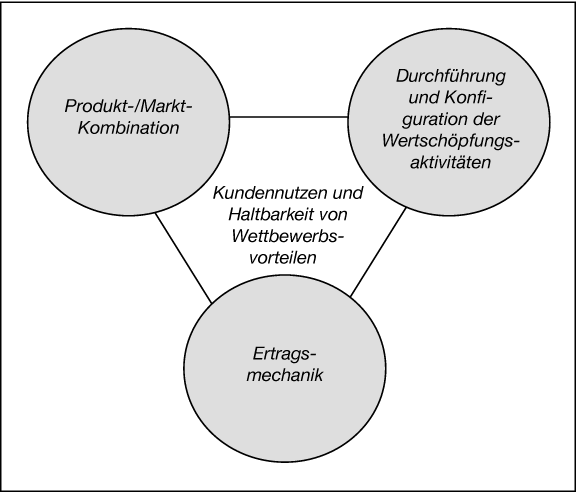
Abb. 1: Bausteine und Zielelemente eines Geschäftsmodells
1. Produkt-/Marktkombination und Transaktionsbeziehungen
Zunächst müssen Unternehmen festlegen, auf welchen Märkten sie mit welchen Produkten konkurrieren wollen und wie die Transaktionsbeziehungen zum Kunden idealerweise gestaltet werden sollen.
Unter einem Markt wird allgemein der Ort des Zusammentreffens von Güterangebot und -nachfrage sowie entsprechender Tauschvorgänge verstanden. Wichtig für die Geschäftsmodellbeschreibung ist dann die Abgrenzung des sog. relevanten Marktes. Dabei handelt es sich um den Teil des Gesamtmarktes, auf den das Unternehmen sein Leistungsangebot und seine Marketingaktivitäten konzentriert. Wachstumspotenziale können insbesondere dann erschlossen werden, wenn eine innovative Marktabgrenzung vorliegt. Dazu ist häufig eine Marktabgrenzung nach funktionalen Kriterien hilfreich: Losgelöst von konkreten Produkten, Verfahren oder Kundengruppen werden Kundenbedürfnisse funktional-abstrakt beschrieben, indem nach dem Problemlösungsbedarf der Kunden gefragt wird, der einem Kauf zugrunde liegt. Ein Beispiel für eine solche funktionale Marktabgrenzung stellen Schließsysteme bestehend aus Schloss und Schlüssel dar (Pfeiffer, Werner/Weiß, Enno/Volz, Thomas et al. 1997). Ein Hersteller derartiger Schließsysteme könnte seinen Markt nach Kriterien wie Anwendungen oder Kundengruppen abgrenzen und ggf. Modifikationen herkömmlicher Schließsysteme, etwa in Werkstoffen oder Qualität, anbieten. Funktional-abstrakt lässt sich das Kundenproblem demgegenüber als „ Zugangskontrolle “ charakterisieren. Damit kommen dann völlig andere technologische Lösungsalternativen in den Blick, etwa Magnetkarten oder eine Personenerkennung anhand biometrischer Merkmale wie Fingerabdruck, Stimme oder Netzhautmuster des Auges.
Das Leistungsangebot eines Unternehmens kann aus Produkten, Dienstleistungen oder sog. „ Enabling Technologies “ bestehen. „ Harte “ Produkte weisen gegenüber Dienstleistungen oft ein höheres Wachstumspotenzial auf. Ein gutes Beispiel bietet die Softwareindustrie: Die Anbieter von Software-Dienstleistungen können nur in dem Maße wachsen, in dem es ihnen gelingt, geeignete Programmierer zu finden bzw. im „ War for Talent “ zu bestehen. Bei Anbietern von Standard-Softwareprodukten ist diese Restriktion nicht gegeben, zumal dann, wenn die Produkte online vertrieben werden können, also keine größere Vertriebsmannschaft notwendig ist. Die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells ist bei Software-Produkten im Vergleich zu Software-Dienstleistungen deshalb meist höher. „ Enabling Technologies “ nehmen eine Zwischenstellung zwischen Produkten und Dienstleistungen ein; sie erleichtern es den Kunden, eigene Geschäftsprozesse auszuführen. Im Biotech-Bereich spricht man in diesem Zusammenhang von Plattformtechnologieunternehmen (siehe oben).
Zur Bestimmung der Transaktionsbeziehung können Anbieter und Nachfrager einer Leistung gegenübergestellt werden. In beiden Dimensionen kann man beispielsweise zwischen „ Consumer “ , „ Peers “ , „ Business “ und „ Administration “ unterscheiden; aus der Kombination ergeben sich dann die oben angesprochenen „ B2C “ -, aber auch „ B2B “ -, „ B&A “ - oder „ P2P “ -Modelle (u.a.m.).
2. Durchführung und Konfiguration der Wertschöpfungsaktivitäten
Mit Hilfe des Konzepts der Wertschöpfungskette (Value Chain; Porter, Michael 1985) ist es möglich, die Unternehmensaktivitäten und ihre Zusammenhänge in der Reihenfolge ihrer Durchführung zu strukturieren sowie Wettbewerbsvorteile herauszuarbeiten. Das Geschäftsmodell wird dann einzelne dieser Wertschöpfungsstufen besonders akzentuieren und deutlich machen, welche Besonderheiten man hier gegenüber anderen Unternehmen besitzt (z.B. überlegenes Produktionsverfahren). Beispielsweise verfolgt (bzw. verfolgte, solange die Konkurrenten noch nicht nachgezogen waren) Dell eine neuartige Vertriebsstrategie bei der Vermarktung von Computersystemen (Direktvertrieb über das Internet statt Einschaltung des Computerfachhandels). Ikea ist ein Beispiel für ein Unternehmen, das in beinahe allen Wertschöpfungsstufen anders vorgeht als traditionelle Möbelhäuser und -fabriken.
Neben der Durchführung einzelner Wertschöpfungsaktivitäten stellt sich die Frage, wie die Konfiguration der Wertschöpfungskette insgesamt aussieht und welche Position das Unternehmen im Wertschöpfungsnetzwerk der Partner (Kunden, Lieferanten, andere Wertschöpfungspartner) besitzen soll (Heuskel, Dieter 1999). Vertikal integrierte Unternehmen leisten den Großteil ihrer Wertschöpfungsaktivitäten in Eigenregie. Spezialisierte Unternehmen konzentrieren sich demgegenüber auf eine Stufe der Wertkette und weisen folglich einen geringen Integrationsgrad auf. So haben es Intel und Microsoft verstanden, einen Großteil der Wertschöpfung in der Computerindustrie auf ihre individuellen Wertschöpfungsstufen (Herstellung und Entwicklung von Mikroprozessoren bzw. Software) zu konzentrieren. In diesem Zusammenhang wird allerdings deutlich, dass nach der Branchenebene differenziert werden muss. Während zum Beispiel Intel innerhalb der Computerindustrie eine Spezialistenrolle einnimmt, weist das Unternehmen innerhalb der Halbleiterindustrie einen hohen vertikalen Integrationsgrad auf. Gleichzeitig versuchen einige Spezialisten, ihre Kompetenzen in mehreren Industrien auszuspielen und damit mehrere Wertschöpfungssysteme zu bedienen. So nutzt das finnische Unternehmen Valmet (seit 2001 Metso Paper Corp.) seine Produktionsfähigkeiten nicht mehr nur in der Zellstoff- und Papierindustrie, sondern wendet sein Wissen auch als Fertigungspartner von Porsche an. Das Orchestrator-Modell ist dadurch definiert, dass ein Unternehmen sich auf die Koordination verschiedener Leistungspartner konzentriert; das entspricht weitgehend dem Konzept Virtueller Unternehmungen (Virtuelle Unternehmungen). Ein Market Maker schließlich fügt in bestehende Wertketten eine zusätzliche Wertschöpfungsstufe der Intermediation ein; damit werden Informationsasymmetrien, im Regelfall Informationsvorsprünge auf Anbieterseite, kompensiert und Informationsgleichheit zwischen Anbietern und Nachfragern hergestellt. Insbesondere wird Transparenz hinsichtlich bestehender Transaktionsmöglichkeiten geschaffen. Ein Beispiel ist die Online-Auktionsfirma Ebay, die eine zuvor nicht vorhandene Plattform für den Handel von auch niedrigwertigen (Gebraucht-)Gütern bietet.
3. Ertragsmechanik/Erlösmodell
Bei der Ertragsmechanik bzw. dem Erlösmodell handelt es sich um das Spektrum unterschiedlicher Ertragsquellen, aus dem der Gesamtertrag eines Unternehmens besteht, sowie um den Zusammenhang und die Gewichtung dieser Ertragsquellen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Umsatzerlöse, die nutzungsabhängig oder -unabhängig erzielt werden können. Nutzungsabhängige Erlöse berücksichtigen den Umfang der erbrachten Leistung, indem sie auf die Dauer (z.B. Minutenpreis bei Telefongesprächen), Menge (Anzahl der verkauften Einheiten) oder die Entfernung (z.B. Tickets bei der Deutschen Bahn) abgestimmt sind. Nutzungsunabhängigen Erträgen liegt ein konstanter Stückpreis zugrunde, der dem Umsatz pro Kunden entspricht. Die Umsatzgenerierung erfolgt häufig auf der Basis von Erträgen, die den Kunden zu konstanten Zahlungen verpflichten, die innerhalb festgelegter Zeitperioden (monatlich, jährlich usw.) gezahlt werden müssen. Datenbankanbieter können z.B. gegen eine monatliche Pauschalgebühr den Zugang zu allen angebotenen Informationen erlauben.
Zwischen den aufgezeigten Kategorien existieren zahlreiche Mischformen. Die Deutsche Telekom verlangt von ihren Kunden z.B. eine monatliche Grundgebühr (nutzungsunabhängige Komponente) und je Zeiteinheit einen festgelegten Preis (nutzungsabhängige Komponente); daneben wird auch eine Flat Rate (wiederum nutzungsunabhängig) angeboten.
Im Zusammenhang mit der Ertragsmechanik ist auch zu klären, wer eigentlich der Zahlungsleistende ist. Bei einer direkten Erlösgenerierung werden die Erlöse direkt von dem Nutzer der primären Leistung des Unternehmens erhoben. Bei indirekter Erlösgenerierung werden die Erlöse von einem Dritten entrichtet, der seinerseits einen Gegenwert in Form einer Sekundärleistung, meist eine Vermittlung oder Ermöglichung einer Transaktion mit dem Nutzer der primären Leistung, erhält; die gewünschte Primärleistung – zumeist Informationen – ist für den Nutzer kostenlos.
4. Kundennutzen
Jedes Geschäftsmodell muss, wenn es Aussicht auf ein Interesse von Investoren haben soll, einen Kundennutzen produzieren. Vorteilhaft ist, wenn der Kundennutzen auch quantitativ belegt werden kann. Dies ist im B2B-Bereich meist leichter als im B2C-Bereich. Immerhin stellt das Marketing die Conjoint-Analyse bereit, mit deren Hilfe es möglich ist, den Nutzwert einzelner Produktmerkmale und deren Ausprägungen mit dem Nutzwert von Preisvariationen zu vergleichen (siehe etwa Simon, Hermann 1992, S. 116 ff.). Die Anwendung dieser Methode ist aber komplex und erfordert viel Erfahrung; junge Unternehmen sind entsprechend schnell überfordert.
Insgesamt ist festzustellen, dass der Kundennutzen häufig überschätzt wird, Geschäftsmodelle unter diesem Aspekt also skeptisch beurteilt werden müssen.
5. Haltbarkeit von Wettbewerbsvorteilen
Neben der Erzielung eines Kundennutzens besteht ein entscheidender Prüfstein für jedes Geschäftsmodell darin, ob einmal erlangte Wettbewerbsvorteile tatsächlich gegen die Angriffe der Konkurrenz verteidigt werden können. Im Prinzip existieren mindestens fünf Arten von Imitationsbarrieren (Reed, Richard/DeFillippi, Robert J. 1990): Patente und andere Schutzrechte, ein zu hoher Zeitbedarf (etwa bei der Realisierung von Erfahrungskurveneffekten; der Marktführer ist immer schon einen Schritt weiter), kausale Ambiguitäten (die genauen Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge sind unbekannt), soziale Komplexität (es müssen zu viele Akteure koordiniert werden) und Spezifität (eine bestimmte Ressource, z.B. ein herausragender Entwickler, ist nur unter bestimmten Kontextbedingungen wertvoll, die in anderen Unternehmen so nicht gegeben sein müssen). Diese Imitationsbarrieren sind allerdings ex ante potenziellen Investoren nicht immer leicht zu vermitteln. Am leichtesten wird man sich mit Patenten tun, die insbesondere in der Chemie- sowie in den Life-Science-Branchen eine große Rolle spielen.
III. Geschäftsmodellinnovationen
Geschäftsmodelle können und müssen sich verändern (Meinhardt, Yves 2002; Broglie, Christian 2004) – sie durchlaufen Lebenszyklen. Geschäftsmodellinnovationen können auf der Ebene der einzelnen Bausteine (Abschnitt II) oder auf der Ebene der Gesamtarchitektur dieser Bausteine angesiedelt sein. Je nach dem, ob es sich um graduelle oder prinzipielle Innovationen handelt, kann dann zwischen graduellen, architektonischen, modularen und prinzipiellen Geschäftsmodellinnovationen unterschieden werden (Zollenkop, Michael 2006). Abb. 2 gibt einen Überblick.
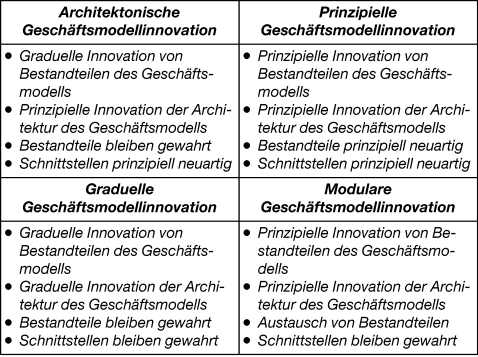
Abb. 2: Typen von Geschäfstmodellinnovationen
Exogene Ursachen für Geschäftsmodellveränderungen bzw.-innovationen sind etwa Strukturverschiebungen bei Kundenbedürfnissen, Trendbrüche in der Technologie oder regulatorische Änderungen seitens des Staates. Für ein betroffenes Unternehmen ist es ggf. existenziell, Anzeichen einer solchen Veränderung frühzeitig – möglicherweise mit Hilfe von Früherkennungssystemen – zu registrieren und entsprechend darauf zu reagieren; je nach Art dieser Entwicklung könnte das Unternehmen entweder gegensteuern oder aber sich zumindest derart vorbereiten, dass es sein Geschäftsmodell rechtzeitig anpasst.
Endogene Ursachen liegen vor, wenn die Innovation vom Unternehmen proaktiv initiiert und durchgeführt wird, um sich bietende Chancen auszuschöpfen. Dabei können sowohl Bestandteile als auch Architektur des Geschäftsmodells optimal geplant und aufeinander abgestimmt werden. Eine Veralterung und Obsoleszenz des Geschäftsmodells wird dadurch von vornherein verhindert; zudem behält das Unternehmen die Gestaltung seiner Zukunft in den eigenen Händen. In diesem Fall ist das Timing der Innovation von hoher Relevanz, da bei einem zu frühen Agieren die Erfolgsaussichten ebenso geschmälert werden wie bei einem verspäteten.
Literatur:
Afuah, Allan/Tucci, Christopher : Internet Business Models and Strategies: Text and Cases, New York & Oxford 2001
Amit, Raffi/Zott, Christoph : Value Creation in E-Business, in: Strategic Management Journal, Jg. 22, H. 6/7/2001, S. 493 – 520
Bieger, Thomas : Geschäftsmodelle im Airline Bereich. Konvergenz oder Ausdifferenzierung, in: Jahrbuch schweizerische Verkehrswirtschaft 2002/2003, hrsg. v. Bieger, Thomas/Laesser, Christian/Maggi, Rico, St. Gallen 2002, S. 1 – 11
Bieger, Thomas/Bickhoff, Nils/Caspers, Rolf : Zukünftige Geschäftsmodelle. Konzept und Anwendung in der Netzökonomie, Berlin et al. 2002
Broglie, Christian : Der Lebenszyklus von Geschäftsmodellen. Idealtypischer Wachstumsverlauf mit Fallbeispielen aus der Schweiz, Zürch et al. 2004
Bux, Ulf : Financial Services – Allfinanzkonzepte, Frankfurt 2002
Casper, Steven : Institutional Adaptiveness, Technology Policy, and the Diffusion of New Business Models: The Case of German Biotechnology, in: Organization Studies, Jg. 21, H. 5/2000, S. 667 – 695
Clement, Reiner : Geschäftsmodelle im Mobile Commerce, in: Mobile Commerce. Grundlagen, Geschäftsmodelle, Erfolgsfaktoren, hrsg. v. Silberer, Günter/Wohlfahrt, Jens/Wilhelm, Thorsten, Wiesbaden 2002, S. 24 – 43
Hass, Berthold : Geschäftsmodelle für Medienunternehmen. Ökonomische Grundlagen und Veränderungen durch neue Informations- und Kommunikationstechnik, Wiesbaden 2002
Heuskel, Dieter : Wettbewerb jenseits von Industriegrenzen. Aufbruch zu neuen Wachstumsstrategien, Frankfurt & New York 1999
Hummel, Johannes : Auswahl und Gestaltung transaktionsorientierter Geschäftsmodelle im Internet. Eine Betrachtung aus Sicht der neuen Institutionentheorie, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Jg. 72, H. 7/2002, S. 713 – 733
Knyphausen-Aufseß, Dodo zu/Meinhardt, Yves : Revisiting Strategy: Ein Ansatz zur Systematisierung von Geschäftsmodellen, in: Zukünftige Geschäftsmodelle. Konzept und Anwendung in der Netzökonomie, hrsg. v. Bieger, Thomas/Bickhoff, Nils/Caspers, Rolf et al., Berlin et al. 2002, S. 63 – 89
Krüger, Wilfried/Bach, Norbert : Geschäftsmodelle und Wettbewerb im e-Business, in: Supply Chain Solutions – Best Practices im E-Business, hrsg. v. Buchholz, Wolfgang/Werner, Hartmut, Stuttgart 2001, S. 29 – 51
Mahadevan, B. : Business Models for Internet-based E-Commerce, in: California Management Review, Jg. 42, H. 4/2000
Meier, Horst : Dienstleistungsorientierte Geschäftsmodelle im Maschinen- und Anlagenbau. Vom Basisangebot bis zum Betreibermodell, Berlin et al. 2004
Meinhardt, Yves : Veränderung von Geschäftsmodellen in dynamischen Industrien. Fallstudien aus der Biotech-/Pharmaindustrie und bei Business-to-Consumer-Portalen, Wiesbaden 2002
Pfeiffer, Werner/Weiß, Enno/Volz, Thomas : Funktionalmarkt-Konzept zum strategischen Management prinzipieller technologischer Innovationen, Göttingen 1997
Porter, Michael : Competitive Advantage, New York 1985
Reed, Richard/DeFilippi, Robert J. : Causal Ambiguity, Barriers to Imitation, and Sustainable Competitive Advantage, in: Academy of Management Review, Jg. 15, H. 1/1990, S. 88 – 102
Rentmeister, Jahn/Klein, Stefan : Geschäftsmodelle. Ein Modebegriff auf der Waagschale, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Jg. 73, Ergänzungsheft 1/2003, S. 17 – 30
Simon, Hermann : Preismanagement. Analyse – Strategie – Umsetzung, 2. A., Wiesbaden 1992
Slywotzki, Adrian : Value Migration. How to Think Several Moves Ahead of the Competition, Boston 1996
Timmers, Paul : Business Models for Electronic Markets, in: Electronic Markets, Jg. 8, H. 2/1998, S. 3 – 8
Zollenkop, Michael : Geschäftsmodellinnovation. Initiierung eines systematischen Innovationsmanagements für Geschäftsmodelle auf Basis lebenszyklusorientierter Frühaufklärung, Wiesbaden 2006
|