|
Produktionstiefenbestimmung
Inhaltsübersicht
I. Gegenstand der Produktionstiefenbestimmung
II. Produktionstiefenbestimmung aus Sicht der Transaktionskostentheorie
III. Instrumente zur Produktionstiefenbestimmung
I. Gegenstand der Produktionstiefenbestimmung
Gegenstand der Produktionstiefenbestimmung ist die Auswahl der innerhalb einer Unternehmung organisierten aufeinander folgenden Prozesse der Produktion eines Gutes. Durch diese Entscheidung wird das Maß der vertikalen Integration der betrachteten Unternehmung bestimmt. In Bezug auf die vertikale Integration vorgelagerter Produktionsstufen spricht man von Make-or-buy-Entscheidungen. Die gleiche Frage kann sich auch für die Integration nachgelagerter Produktionsstufen stellen. Mit der Entscheidung, bestimmte Leistungen innerhalb der Unternehmung zu erbringen, sind i.d.R. erhebliche u. irreversible Investitionen zu Sach- und/oder Humankapital verbunden, die Entscheidung über die Produktionstiefe hat daher strategischen Charakter. Sie ist zu trennen von der operativen Entscheidung, nach bereits erfolgten Investitionen einzelne Einheiten eines Produktes selbst herzustellen oder über den Markt zu beziehen. Kurzfristig ausgerichtete kostenrechnerische Ansätze für diese operative Entscheidung (z.B. Männel, W. 1981) sind daher nicht zur methodischen Unterstützung der Produktionstiefenbestimmung geeignet (Picot, A. 1991).
Die strategische Entscheidung über die Produktionstiefe muss im konkreten Einzelfall eine Vielzahl von Einflussfaktoren berücksichtigen, welche die Ein- oder Auslagerung bestimmter Leistungen nahe legen oder ihr entgegenstehen können (z.B. Porter, M. E. 1988). Die Transaktionskostentheorie (Coase, R. 1937; Williamson, O. E. 1990; Picot, A. 1991) gestattet über diese Einzelfaktoren hinausgehend allgemeine Aussagen zu den ökonomischen Konsequenzen alternativer Ausprägungen der Produktionstiefe. Produktionsprozesse, in denen sich u.U. Skalenerträge realisieren lassen, werden in der Transaktionskostentheorie gemeinsam analysiert mit den Prozessen der Information und Kommunikation, die zur Koordination aufeinander folgender Produktionsprozesse erforderlich sind. Investitionen in Sach- oder Humankapital, die (im Extremfall) in nur einer Verwendung wirtschaftlich sinnvoll eingesetzt werden können, führen unter bestimmten Verhaltensannahmen zu Koordinationsproblemen. Solche Investitionen können Spielräume für Erpressungen (»hold-up«) durch Unternehmen auf vor- oder nachgelagerten Produktionsstufen eröffnen. Die Produktionstiefenbestimmung wird damit zu einem Problem der Produktions- und der Organisationstheorie. Zur Lösung kann ein ganzes Spektrum von Beherrschungs- und Überwachungssystemen (Williamson, O. E. 1990) eingesetzt werden, das von der Koordination durch Hierarchien über Kapitalbeteiligungen, Kooperationen oder Jahresverträge bis zur marktlichen Koordination reicht (Picot, A. 1991). Die Produktionstiefe eines Unternehmens ergibt sich somit als Lösung eines Organisationsproblems. Ihre Kennzeichnung erfolgt differenzierter, als es die Frage »Eigenfertigung vs. Fremdbezug« zunächst nahe legt. Auf der Grundlage der Transaktionskostentheorie lassen sich schließlich Normstrategien entwickeln, die im konkreten Einzelfall theoretisch begründete Hinweise zur Ein- oder Auslagerung bestimmter Leistungen geben.
II. Produktionstiefenbestimmung aus Sicht der Transaktionskostentheorie
Die Entwicklung der Transaktionskostentheorie lässt sich auf zwei Fragen zurückführen. Ausgangspunkt ist der Gedanke, dass gemäß der neoklassischen Wirtschaftstheorie in einer Marktwirtschaft die wirtschaftliche Aktivität der produzierenden und konsumierenden Einheiten grundsätzlich durch den Preismechanismus koordiniert wird. Dies führt zu der ersten Frage, warum unter Wettbewerbsbedingungen Unternehmungen entstehen, innerhalb derer die Produktionsprozesse nicht durch den Preismechanismus, sondern durch Hierarchien koordiniert werden (Coase, R. 1937). Geht man davon aus, dass die Koordination durch Hierarchien in diesen Fällen Effizienzvorteile gegenüber der Koordination durch den Preismechanismus haben muss, so schließt sich unmittelbar die zweite Frage an, warum nicht alle produzierende Aktivität innerhalb einer einzigen Unternehmung organisiert wird.
Diese Fragen lassen sich beantworten, wenn man das empirische Phänomen »Unternehmung« im Gegensatz zur neoklassischen Wirtschaftstheorie nicht als die »black box« einer technologisch determinierten Produktionsfunktion modelliert, sondern die Unternehmung als ein »Geflecht von Verträgen« (Alchian, A. A./Demsetz, H. 1972; Fama, E. 1980; Aoki, M./Gustafsson, B./Williamson, O. E. 1990; Cheung, S.N. S. 1983; Furubotn, E. G./Richter, R. 1991; Hax, H 1991; Richter, R. 1991) zwischen Individuen ansieht, das zur ökonomisch effizienten Lösung eines Organisationsproblems dient. Dazu wird in einem mikroanalytischen Ansatz das erwartete Verhalten der an der Unternehmung beteiligten Individuen analysiert. Das Organisationsproblem besteht dann in der simultanen Koordination und Motivation der Individuen innerhalb des produzierenden Bereichs (Milgrom, P./Roberts, J. 1992).
Die Organisation von Produktionsprozessen innerhalb einer Unternehmung stellt nur eine von mehreren möglichen Lösungen für dieses Problem dar. In bestimmten Situationen weist sie Effizienzvorteile gegenüber anderen Lösungen auf und setzt sich daher unter Wettbewerbsbedingungen durch. Man versucht, die Effizienz alternativer Lösungen durch eine komparative institutionelle Analyse abzuschätzen. Im Hinblick auf die vertikale Integration werden somit solche Produktionsstufen innerhalb einer Unternehmung zusammengefasst, für die alternative Lösungen des Organisationsproblems weniger effizient sind.
1. Verhaltensannahmen
Wenn in einem mikroanalytischen Ansatz das Verhalten der an einer Produktion beteiligten Individuen betrachtet wird, so kommt den zugrunde gelegten Verhaltensannahmen eine zentrale Bedeutung zu. Diese Annahmen stellen ein gegenüber der Realität bewusst vereinfachendes, theoretisches Konstrukt dar und dienen in der Analyse als methodisches Hilfsmittel. a) Eigennutz und beschränkte Rationalität
In der neoklassischen Theorie werden die Präferenzen der Individuen durch Nutzenfunktionen modelliert. Man unterstellt, dass die Individuen aufgrund der Markttransparenz ohne Anstrengung die Handlung wählen, die ihren individuellen Nutzen maximiert. Ein derartiges nutzenmaximierendes Verhalten wird in dieser Modellwelt als rational bezeichnet. Die Transaktionskostentheorie geht dagegen davon aus, dass dem individuellen Streben nach Nutzenmaximierung durch die beschränkten kognitiven Fähigkeiten des Menschen Grenzen gesetzt sind, deren sich die handelnden Individuen auch bewusst sind. Aufgrund dieser Grenzen sind sie nicht in der Lage, beliebig komplexe Entscheidungsprobleme exakt, ohne zeitliche Verzögerung und ohne den Einsatz knapper Güter im Entscheidungsprozess selbst zu lösen und die dazu erforderlichen Informationen untereinander auszutauschen. Sie berücksichtigen diese Grenzen ihrer kognitiven Fähigkeiten bei der Auswahl ihrer Entscheidungen. Das Bemühen um individuelle Nutzenmaximierung angesichts beschränkter kognitiver Fähigkeiten wird vielfach nach Simon als »beschränkte Rationalität«(March, J. G./Simon, H. 1993) bezeichnet. b) Opportunismus
In der Transaktionskostentheorie nimmt man an, dass die Individuen ihre Interessen mit List verfolgen. Dazu gehören u.a. Verhaltensweisen wie Lügen, Diebstahl, Betrug und Verrat. Handlungsspielräume für solche Verhaltensweisen können z.B. dann entstehen, wenn aufgrund von Informationsasymmetrien nicht alle Informationen für alle Individuen frei verfügbar sind und/oder einmal getroffene Vereinbarungen nicht kostenlos durchgesetzt werden können. Vor und nach Vertragsabschluss entstehen jeweils Spielräume für opportunistisches Verhalten, die von den beteiligten Individuen auch ohne Rücksicht auf ggf. abgegebene eigene Versprechen, ethische Normen und die Konsequenzen für den Vertragspartner ausgenutzt werden. Vor Vertragsabschluss besteht die als adverse selection bezeichnete Gefahr, Vertragspartner mit unerwünschten Eigenschaften auszuwählen, da diese die Informationen über ihre eigenen Eigenschaften verzerrt weitergeben. Nach Vertragsabschluss muss davon ausgegangen werden, dass die Vertragspartner ein vom Vertrag abweichendes Verhalten (moral hazard) zeigen, wenn dies ihren individuellen Interessen in Anbetracht der unterstellten Verhaltensspielräume der Vertragspartner förderlich ist. Alle Individuen unterstellen ihren Vertragspartnern derartige Verhaltensweisen. Im Hinblick auf die Produktionstiefenbestimmung ist ein Grad an vertikaler Integration zu wählen, der ein opportunistisches Abweichen von geschlossenen Verträgen verhindert.
2. Spezifität von Investitionsgütern
Investitionsgüter werden für eine bestimmte Verwendung erstellt. Ihr wirtschaftlicher Nutzen ist in dieser Verwendung häufig erheblich größer als in alternativen Verwendungen, die nach erfolgter Investition noch möglich sind. Der Unterschied des wirtschaftlichen Nutzens zwischen der besten und der zweitbesten Verwendung des Investitionsgutes wird als »Quasi-Rente« bezeichnet. Je größer diese Quasi-Rente ist, desto höher ist die Spezifität des betrachteten Investitionsgutes. Im Extremfall ist ein Investitionsgut in nur einer Verwendung produktiv einsetzbar.
3. Transaktionen und Transaktionskosten
Als Transaktion (Commons, J. R. 1924, Commons, J. R. 1931) wird die Übertragung von Verfügungsrechten (property rights) an einem Gut bezeichnet, die mit dem Leistungsaustausch in arbeitsteilig organisierten Wirtschaften zwingend verbunden ist. Diese Verfügungsrechte betreffen die Festlegung der Nutzungsart, die Aneignung der Gewinne sowie das Recht zur Veränderung und zur Veräußerung des Gutes. Die Individuen werden eine Vereinbarung über die Durchführung einer Transaktion nur dann treffen, wenn ihre Wirtschaftspläne koordiniert sind. Die neoklassisch Wirtschaftstheorie unterstellt, dass diese Koordination über den Preismechanismus ohne den Verbrauch knapper Güter im Koordinationsprozess selbst erfolgt. Auf Coase (Coase, R. 1937) geht die Überlegung zurück, dass die Nutzung des Preismechanismus in der Realität nicht kostenlos ist. Die Koordination von Wirtschaftsplänen führt vielmehr zu Kosten, die als Analogon zum Phänomen der »Reibung« in physikalischen Systemen betrachtet werden können (Williamson, O. E. 1990). Es handelt sich um Kosten der Anbahnung, Vereinbarung, Abwicklung, Kontrolle und Anpassung von Transaktionen. Sie werden als Transaktionskosten bezeichnet(Williamson, O. E. 1990). Ihre Höhe hängt einerseits von den Charakteristika der zugrunde liegenden Transaktion und der für die Produktion erforderlichen Investitionsgüter ab. Andererseits schlägt sich in ihnen auch das institutionelle Arrangement nieder, das zur Abwicklung der Transaktion ¯eingesetzt wird. Der Grundgedanke der Transaktionskostentheorie ist, dass sich unter Wettbewerbsbedingungen institutionelle Arrangements bilden, die zu den geringsten Kosten der Produktions- und Transaktionsprozesse führen. Die Transaktionskosten sind die Kosten der Koordination und Motivation (Milgrom, P./Roberts, J. 1992) der an der Transaktion beteiligten Individuen.
Merkmale von Transaktionen sind nach Williamson neben der Spezifität der eingesetzten Investitionsgüter ihre Häufigkeit und ihre Unsicherheit. Wenn bestimmte Transaktionen häufig erfolgen, so stellen sich zwei Fragen. Zum einen kann man untersuchen, ob die Realisation von Skalenerträgen möglich ist, wenn Produktionsmengen zusammengefasst werden. Zum anderen ist zu prüfen, ob bei häufigen Transaktionen bestimmte Verfahren zur Übertragung der Verfügungsrechte Effizienzvorteile gegenüber anderen Verfahren aufweisen. Beide Fragestellungen sind simultan zu analysieren. Die Unsicherheit ergibt sich daraus, dass einerseits künftige Umweltsituationen u.a. aufgrund der beschränkten Rationalität nicht antizipiert werden können. Zusätzlich existiert eine Verhaltensunsicherheit, die sich aus der Neigung aller Individuen ergibt, Handlungsspielräume opportunistisch auszunutzen und dies auch ihren Vertragspartnern zu unterstellen.
4. Transaktions- und Vertragstypen
Die ökonomische Aktivität zwischen Unternehmen wird in einer Marktwirtschaft durch freiwillig abgeschlossene Verträge koordiniert. In der neoklassischen Theorie geht man davon aus, dass Verträge einen klar beschriebenen Austausch von Gütern zu einem bestimmten Zeitpunkt regeln. Die Identität der Vertragspartner spielt in derartigen klassischen Verträgen keine Rolle, die Vertragsbeziehung ist auf einen Zeitpunkt bezogen. Die mit Nichterfüllung des Vertrages verbundenen Konsequenzen sind für die Vertragspartner vor Vertragsabschluss klar, sie lassen sich durch einen Rechtsstreit durchsetzen. Derartige Vertragsbeziehungen treten z.B. beim Kauf von Benzin an Tankstellen auf.
Macneil (Macneil, I. R. 1978) zeigt, dass neben den klassischen Verträgen auch andere Formen des Vertragsrechts zur Abwicklung von Transaktionen herangezogen werden. Häufig beziehen sich Verträge nicht auf einen einzelnen, zeitlich punktuellen Leistungsaustausch, die Leistungsbeziehung ist vielmehr langfristig angelegt und umfasst mehrere Transaktionen. Dies gilt vor allem dann, wenn es aufwendig ist, überhaupt einen Transaktionspartner zu finden und beide Partner ein ökonomisch begründetes Interesse haben, die Leistungsbeziehung auch dann auf längere Sicht aufrechtzuerhalten, wenn Streitigkeiten über die gegenseitige Vertragserfüllung auftreten.
Die Vertragsbeziehung muss daher die Unsicherheit über das künftige Geschehen berücksichtigen. Der Abschluss eines vollständigen Vertrages, der für alle denkbaren künftigen Situationen explizite Regelungen vorsieht, ist angesichts der beschränkten kognitiven Fähigkeiten (»beschränkte Rationalität«) der Individuen nicht möglich oder zumindest prohibitiv aufwendig. Ein klassischer Vertrag kann daher in einer solchen Situation nicht geschlossen werden. Geht man davon aus, dass sich die Individuen opportunistisch verhalten, so kann man noch nicht einmal annehmen, dass sie die jeweils nur ihnen selbst bekannten Informationen einander offen legen. Aufgrund des unterstellten opportunistischen Verhaltens kann der Unsicherheit auch nicht durch eine »Generalklausel« begegnet werden (Williamson, O. E. 1990). In einer derartigen Klausel des Vertrags könnten sich die Partner zu einem kooperativen Verhalten nach Vertragsabschluss verpflichten, das zur größten gemeinsamen Rente führt. Unsicherheit und opportunistisches Verhalten werden somit erst dann zum Problem, wenn sie gemeinsam auftreten.
Dennoch kann eine Leistungsbeziehung für beide potenziell daran beteiligten Partner vorteilhaft sein. Sie werden daher möglicherweise sog. neoklassische Verträge abschließen, die bewusst unvollständig formuliert sind. Gegenstand des Vertrages ist u.a. die Festlegung eines Schlichtungsverfahrens durch eine dritte Partei, mit der die möglichen Streitfälle hinsichtlich der Leistungserfüllung unparteiisch gelöst werden sollen. Man geht davon aus, dass der Einsatz eines sachkundigen Schlichters eher zu einer für beide Seiten akzeptablen Lösung führt als ein Rechtsstreit vor einem Gericht, das zum einen weniger sachkundig und zum anderen stärker an formale Verfahrensregeln gebunden ist. Ein Beispiel für einen neoklassischen Vertrag ist eine langfristige Rahmenvereinbarung.
Wenn die Leistungsbeziehung so komplex ist, dass als Ansatzpunkt für die Lösung von Streitigkeiten nicht mehr die einzelne Transaktion, sondern die Gesamtheit der Leistungsbeziehungen betrachtet werden muss, so werden sog. relationale Verträge geschlossen. Diese Verträge sind inhaltlich noch offener als die neoklassischen Verträge, sie werden erst durch das Verhalten der Vertragsparteien im Zeitablauf konkretisiert. Die Vertragsbeziehung nimmt die Form einer »minisociety« an (Macneil, I. R. 1978). In dieser Situation ist auch ein unparteiischer Schlichter nicht mehr in der Lage, sachgerechte Lösungen für Streitfälle vorzugeben, da er dazu die komplexe Beziehung in ihrer Gesamtheit beurteilen müsste. Die Lösung von Konflikten kann hier nur durch die Vertragspartner selbst erfolgen. Beispiele sind Arbeitsverträge, bestimmte Gesellschaftsverträge oder Ehen. In allen Fällen basiert die Beziehung in einem hohen Maß auf impliziten Vereinbarungen und stillschweigendem Einverständnis (Wolff, B. 1994).
5. Vertikale Integration als Kontraktproblem
Investitionen in beziehungsspezifische Vermögensgegenstände können Spielräume für opportunistisches Handeln öffnen. Dies gilt dann, wenn die Individuen aufgrund der Unsicherheit und ihrer beschränkten kognitiven Fähigkeiten nicht in der Lage sind, solche Verträge zu schließen, die alle möglichen Entwicklungen der zukünftigen Welt berücksichtigen und die kostenlos durchsetzbar sind. Unterstellt man ferner, dass sich die Individuen opportunistisch verhalten, so führen Transaktionen, die erhebliche spezifische Investitionen voraussetzen, auf ein als »hold-up« bezeichnetes Problem der Erpressbarkeit.
Ausgangspunkt ist die Überlegung, dass nach erfolgter Investition durch den einen Partner an der Transaktion ein Anreiz für den anderen Partner entstehen kann, den ursprünglich geschlossenen Vertrag zu brechen und durch einseitige Veränderung der zuvor vereinbarten Preise die Quasi-Rente des ersten Partners abzuschöpfen, der die spezifische Investition getätigt hat. Wenn beide Partner Investitionen in nur gemeinsam einsetzbare Produktionsfaktoren unternommen haben, so kann die Situation des Gefangenendilemmas entstehen, in der für jeden Partner ein Anreiz zu unkooperativem Verhalten entsteht.
Eine einseitige Abhängigkeit könnte z.B. dann entstehen, wenn ein Rohstoff in einem abgelegenen Gebiet gefördert und von dort wegtransportiert werden soll. Der Transport kann nur durch eine aufwendig zu errichtende Eisenbahnlinie durchgeführt werden. Die Förderung der Rohstoffe könnte durch mehrere konkurrierende Unternehmen erfolgen. Sie setzt spezifische Investitionen z.B. für den Bau von unterirdischen Schächten voraus. Für die Schächte existiert keine alternative Verwendungsmöglichkeit. Wenn die Investitionen in die Fördereinrichtungen erfolgt sind, so entsteht für das transportierende Unternehmen ein Anreiz, die Ankaufs- oder Transportpreise für die Rohstoffe einzelner oder aller fördernder Unternehmen entgegen vorher getroffenen Vereinbarungen zu verändern. Dadurch kann es die Quasi-Renten der fördernden Unternehmen abschöpfen. Da die potenziell fördernden Unternehmen diese »hold-up«-Situation antizipieren, werden sie nicht in die Fördereinrichtungen investieren. Im Ergebnis unterbleibt aufgrund des Anreizproblems eine sozial wünschenswerte Produktion. Gestaltet man die Produktionstiefe jedoch so, dass Förderung und Transport durch das einheitliche Beherrschungs- und Überwachungssystem innerhalb eines einzelnen Unternehmens koordiniert werden, so kann man diese Anreizprobleme umgehen.
Williamson (Williamson, O. E. 1990) hat den Transaktionsbeziehungen nach den Kriterien der Unsicherheit und Häufigkeit sowie der Spezifität der eingesetzten Investitionsgüter bestimmte Typen von effizienten Beherrschungs- und Überwachungssystemen zugeordnet. Aus theoretischer wie aus praktischer Sicht ist vor allem der Fall unsicherer Transaktionen relevant. Klassifiziert man die Transaktionen im Hinblick auf ihre Häufigkeit in wiederholt vs. gelegentlich auftretende und die installierten Investitionsgüter als nicht spezifisch, gemischt und hochspezifisch, so gelangt man zu der Darstellung in Abb. 1.
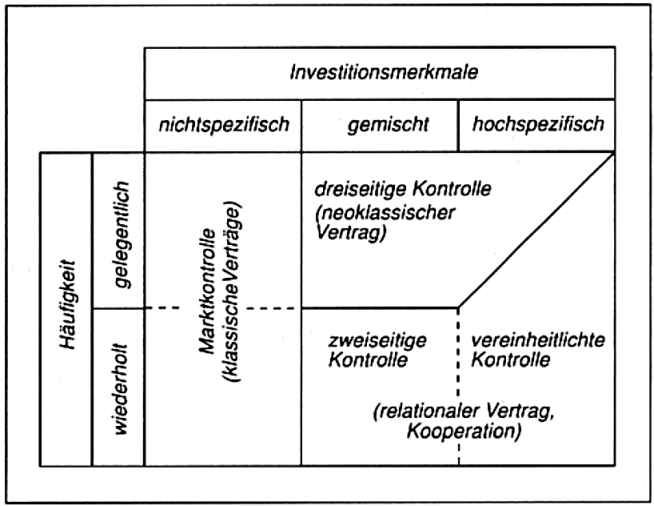
Abb. 1: Effiziente Beherrschung und Überwachung (Williamson, O. E. 1985, Williamson, O. E. 1990)
Wenn Leistungen nicht von der Identität der daran beteiligten Parteien abhängen, so werden für die Leistungserstellung Investitionsgüter eingesetzt, die im Hinblick auf die einzelne Transaktion nicht spezifisch sind. In diesem Fall führt die Beherrschung und Überwachung durch den Markt zu einer effizienten Lösung, da die Transaktionspartner leicht ausgetauscht werden können, wenn sie die Vereinbarungen des Vertrages nicht einhalten. Keiner der Vertragspartner hat ein ausgeprägtes Interesse, eine bestimmte Leistungsbeziehung aufrechtzuerhalten. Wenn die Transaktion aus der Sicht eines Vertragspartners häufig erfolgt, so kann er das Verhalten des anderen aus seiner eigenen Erfahrung heraus beurteilen, bei nur gelegentlichen Transaktionen bietet sich der Rückgriff auf die Dienste von Rating-Agenturen, Verbraucherzentralen oder Beratungsstellen an. In dieser Situation empfiehlt sich daher die Koordination durch klassische Verträge. Sie erlaubt es, Leistungsprozesse zu aggregieren und in der Produktion Skalenerträge auszunutzen. Ein Beispiel ist die Herstellung von Schrauben oder Nägeln, bei denen die Übertragung der Verfügungsrechte üblicherweise durch den Markt erfolgt. In derartigen Situationen legt die Transaktionskostentheorie im Hinblick auf die Produktionstiefenbestimmung den externen Bezug der Leistung nahe.
In dem Fall gemischter oder hochspezifischer Investitionen und nur gelegentlich durchgeführter Transaktionen haben beide Vertragspartner ein Interesse daran, die Vertragsbeziehung aufrechtzuerhalten. Der jeweils andere Vertragspartner ist nach Vertragsabschluss nicht mehr beliebig austauschbar. Damit kann die Koordination über den Markt nicht mehr vor opportunistischem Verhalten schützen. Die Drohung, den Vertragspartner zu wechseln, ist angesichts bereits erfolgter spezifischer Investitionen nicht glaubhaft. Andererseits lohnt es sich aufgrund der nur gelegentlich durchgeführten Transaktion auch nicht, ein transaktionsspezifisches Beherrschungs- und Überwachungssystem aufzubauen. Hier bietet sich das neoklassische Vertragsrecht an mit der Möglichkeit, bei Konflikten eine dritte Partei als Schlichter oder Schiedsstelle anzurufen. Die Produktionstiefenbestimmung erfolgt durch Lösungen, die zwischen den Extremen der Eigenerstellung und dem spontanen Einkauf am Markt liegen. Eine empirische Untersuchung (Maher, M. E. 1994) berichtet von dem Einsatz einer Schlichtungsstelle bei Unternehmen des Maschinenbaus.
Wenn gemischt- oder hochspezifische Transaktionen häufig vorkommen, so haben einerseits beide Partner an der Transaktion aus den o.g. Gründen ein Interesse, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Andererseits lohnen sich nun auch die Aufwendungen für transaktionsspezifische Beherrschungs- und Überwachungssysteme. Für derartige Situationen lassen sich relationale Verträge einsetzen. Solange die Investitionen nicht völlig spezifisch sind, können die Partner noch eine gewisse Eigenständigkeit behalten. Durch die Beschaffung »von außen« werden so bürokratische Verzerrungen eingedämmt. Wenn die Investitionen dagegen hochspezifisch sind, so erweist sich eine vereinheitlichte Kontrolle innerhalb eines einzelnen Unternehmens als effiziente Lösung. Da die Leistung hochspezifisch ist, können Produktionsmengen nicht aggregiert werden, sodass sich in der Produktion Skalenerträge nicht nutzen lassen. Im Hinblick auf die reinen technisch bedingten Produktionskosten kann ein Fremdbezug daher keine Vorteile aufweisen. Er würde jedoch aufgrund der hochspezifischen Investitionen in die geschilderten Anreizprobleme führen. Aus diesem Grund ist hier die vereinheitlichte Kontrolle von aufeinander folgenden Produktionsstufen das effiziente Beherrschungs- und Überwachungssystem. In diesem Fall empfiehlt sich also die vertikale Integration der aufeinander folgenden Produktionsstufen. Die mit Abb. 1 nur grob klassifizierten Fälle zeigen bereits, dass sich im Hinblick auf die Produktionstiefenbestimmung mehr Möglichkeiten zur Vertragsgestaltung bieten, als dies durch die vereinfachende Frage »make oder buy?« suggeriert wird.
Wenn man nur die technisch bestimmten Produktionskosten betrachtet, so kann es nie sinnvoll sein, identische Produktionen in zwei verschiedenen Unternehmen durchzuführen, da so nicht die maximal möglichen Skalenerträge dieser Produktion realisiert werden können. Im Hinblick auf die isoliert betrachteten Kosten der Produktion wäre es durchaus denkbar, alle Produktionen verschiedener Güter innerhalb einer Unternehmung zu organisieren. Dagegen sprechen offensichtlich die Transaktionskosten der internen Beherrschung und Überwachung. Sie können bei der erforderlichen Bürokratisierung der so entstehenden fiktiven »Superunternehmung« aufgrund von Anreizproblemen so groß werden, dass die Koordination und Motivation der Akteure über den Markt effizienter ist. Antworten auf die beiden eingangs gestellten Fragen nach dem Grund für die Existenz von Unternehmen und ihre vertikalen Grenzen erhält man damit aus der Transaktionskostentheorie.
6. Eigenfertigung und Fremdbezug in Abhängigkeit von Produktions- und Transaktionskosten
Die ökonomisch begründete Entscheidung über die Integration einer bestimmten Produktikonsstufe in einem Unternehmen kann nur dann erfolgen, wenn die Koten der Produktion und die Transaktionskosten simultan betrachtet werden. Beide hängen von der Spezifität der Transaktionsbeziehung bzw. der erforderlichen Investitionen ab. In der Abb. 2 wird der Produktionskostenvorteil ΔG des externen Bezugs einer Leistung in Abhängigkeit von der Spezifität k der erforderlichen Investitionen in Sach- und Humankapital abgebildet.
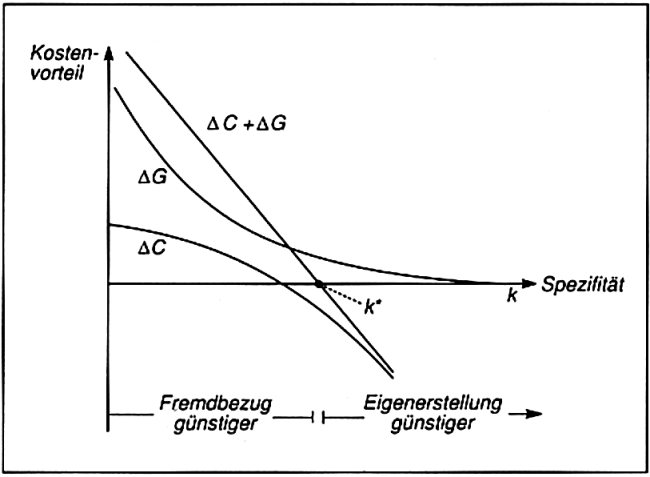
Abb. 2: Produktions- und Transaktionskostenvorteile des externen Bezugs in Abhängigkeit von der Spezifität (Williamson, O. E. 1985, Williamson, O. E. 1990)
Ist die Spezifität k gering, so können Skalenerträge ausgenutzt werden, wenn ein oder wenige Lieferanten z.B. die Produktion von Schrauben durchführen und mehrere Unternehmen beliefern. Bei interner Leistungserstellung lassen sich diese Skalenerträge u.U. nicht realisieren. Der externe Bezug führt also auf einen positiven Produktionskostenvorteil ΔG. Dieser wird jedoch um so niedriger, je höher die Spezifität der erforderlichen Investitionen ist, da sich mit zunehmender Spezifität immer geringere Skalenerträge erreichen lassen. Der Produktionskostenvorteil ΔG des externen Bezugs kann bei hochspezifischen Leistungen bis auf null absinken. Die Kosten des erforderlichen Beherrschungs- und Überwachungssystems hängen ebenfalls von der Spezifität ab. In der Abb. 2 wird der Transaktionskostenvorteil ΔC des externen Bezugs in Abhängigkeit von der Spezifität dargestellt. Bei eher unspezifischen Transaktionen erweist sich die Koordination über den Markt als günstiger, der Transaktionskostenvorteil ΔC ist daher zunächst positiv. Mit zunehmender Spezifität wird eine Koordination über den Markt aufgrund der entstehenden Anreizprobleme immer aufwendiger, sodass die interne Koordination zu niedrigeren Transaktionskosten führt. In diesem Fall ist der Transaktionskostenvorteil des externen Bezugs ΔC negativ. Solange die Summe der Produktions- und Transaktionskostenvorteile ΔG + ΔC des externen Bezugs positiv ist, lohnt es sich, die betrachtete Leistung fremd zu beziehen. Erst ab einer bestimmten Spezifität k* ist es ökonomisch effizient, auf die Eigenerstellung überzugehen. Die Abb. macht deutlich, dass die Produktionskosten alleine nicht den Ausschlag für eine Eigenerstellung geben können. Man erkennt ferner, dass das optimale Maß der vertikalen Integration durch die simultane Minimierung der Transaktions- und Produktionskosten bestimmt wird.
III. Instrumente zur Produktionstiefenbestimmung
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sind Instrumente zur Produktionstiefenbestimmung wertvoll, die auf einem klaren theoretischen Fundament zu Handlungsempfehlungen führen. Dies kann durch Portfolio-Darstellungen methodisch unterstützt werden, an die bestimmte Normstrategien geknüpft sind. Diese Portfolios (Picot, A. 1991) basieren auf der Transaktionskostentheorie und berücksichtigen zusätzlich, dass Leistungen neben der Spezifität, Häufigkeit und Unsicherheit durch eine strategische Bedeutung gekennzeichnet sind. Hochspezifische Leistungen ermöglichen es den Unternehmen, sich von ihren Wettbewerbern zu differenzieren. Daher sind Leistungen von strategischer Bedeutung i.d.R. hochspezifisch. Nicht alle spezifischen Leistungen, die im Unternehmen erbracht werden, sind gleichzeitig von hoher strategischer Bedeutung. Dies gilt z.B. häufig für Softwarelösungen. Wenn man davon ausgeht, dass höhere Spezifität tendenziell zu höheren Transaktionskosten führt, liegt der Gedanke nahe, dass nur hochspezifische Leistungen von strategischer Bedeutung im Unternehmen erbracht werden sollten.
Der Ein- oder Auslagerung von Leistungen können aber im konkreten Fall erhebliche Barrieren entgegenstehen. Eine wesentliche Determinante ist die Verfügbarkeit von Know-how und Kapital (Picot, A. 1991) für die zu erbringende Leistung. Die mangelnde Verfügbarkeit kann sich auf das eigene Unternehmen beziehen und die Einlagerung von Leistungen erschweren. Denkbar ist auch, dass sich für Leistungen von geringer strategischer Bedeutung kein Partner findet, dem das erforderliche Kapital und Know-how zur Verfügung steht. Barrieren, die einer Auslagerung entgegenwirken, können sich daneben z.B. aus beschäftigungspolitischen Konsequenzen ergeben. Ferner kann die Auslagerung von Leistungen Auswirkungen auf das Kundenverhalten haben. So könnte z.B. die Entscheidung eines fiktiven Herstellers von Luxusfahrzeugen, die Motoren künftig von einem Anbieter preisgünstiger Fahrzeuge herstellen zu lassen, dazu führen, dass die Kunden das Fahrzeug nicht mehr als »Luxusfahrzeug« betrachten und der Absatz möglicherweise zurückgeht.
In den Portfolios in Abb. 3 und 4 wird horizontal die Stärke der Ein- oder Auslagerungsbarrieren abgetragen. Vertikal werden Spezifität, Unsicherheit und strategische Bedeutung in einer Dimension gemeinsam betrachtet. Dies kann zu Abgrenzungsproblemen führen. Betrachtet man zunächst in Abb. 3 den Fall der bislang fremdbezogenen Leistungen, so wird deutlich, dass Leistungen von geringer Spezifität und strategischer Bedeutung weiterhin extern bezogen werden sollten. Durch den Aufbau von weiteren Lieferanten können eventuell günstigere Konditionen erreicht werden. Bei mittlerer strategischer Bedeutung und niedrigen Einlagerungsbarrieren empfiehlt sich u.U. eine partielle Integration, bei hohen Einlagerungsbarrieren bieten sich Langfristverträge an. Sind Spezifität und strategische Bedeutung hoch, so ist bei niedrigen Einlagerungsbarrieren auf die Eigenerstellung überzugehen. Wenn dies aufgrund hoher Einlagerungsbarrieren nicht möglich ist, so sind andere enge Kooperationsformen in Betracht zu ziehen.
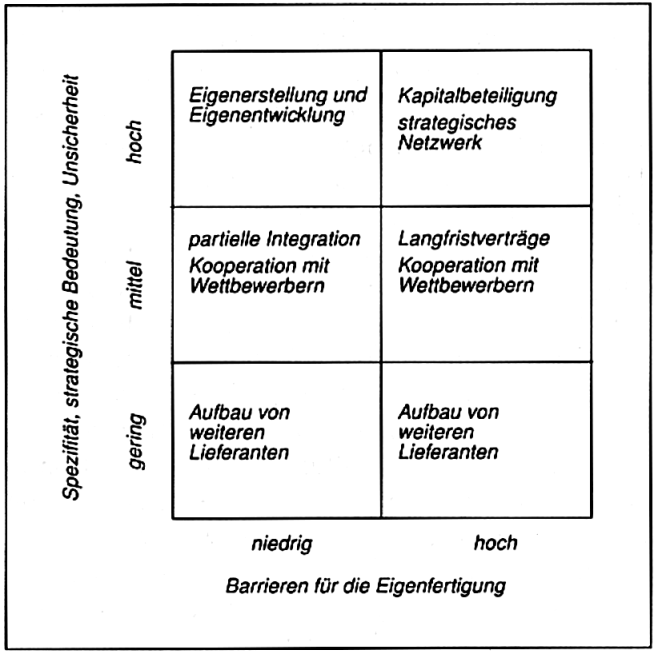
Abb. 3: Strategieempfehlungen für bislang fremdbezogene Leistungen (Picot, A. 1991)
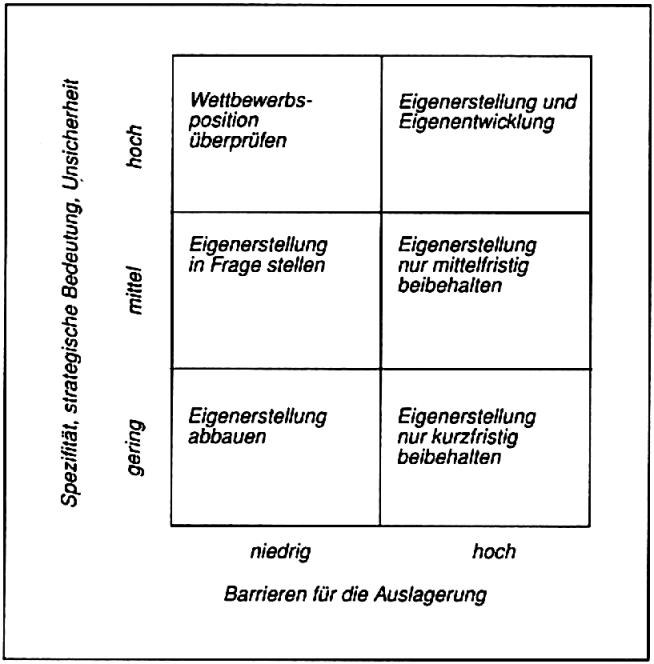
Abb. 4: Strategieempfehlungen für bislang eigenerstellte Leistungen (Picot, A. 1991, Gerhard, T./Nippa, M./Picot, A. 1992)
Für eine systematische Bestimmung der Produktionstiefe sind gemäß Abb. 4 auch die bislang selbst erstellten Leistungen zu untersuchen.
Bei Leistungen von hoher Spezifität und strategischer Relevanz sowie hohen Auslagerungsbarrieren sollte die Eigenerstellung beibehalten werden. Existieren bei derartigen transaktionskostenintensiven Leistungen dagegen nur geringe Auslagerungsbarrieren, so ist die eigene Wettbewerbsposition zu überprüfen, da zentrale Leistungen des Unternehmens offensichtlich am Markt verfügbar sind oder vergleichsweise leicht bereitgestellt werden könnten (Gerhard, T./Nippa, M./Picot, A. 1992). In diesem Fall scheint die Wettbewerbsposition des Unternehmens gefährdet. Leistungen von geringer Bedeutung und Spezifität sind nach Möglichkeit abzubauen.
Die Argumentation anhand dieser Portfolios zeigt, dass auf der Grundlage des Transaktionskostenansatzes konkrete Handlungsempfehlungen zur Produktionstiefenbestimmung abgeleitet werden können. Eigenfertigung und Fremdbezug spannen ein Spektrum von Beherrschungs- und Überwachungssystemen zur Koordination aufeinander folgender Produktionsstufen auf. Die situationsspezifische Wahl der Koordinationsform kann die Ein- und Auslagerungsbarrieren berücksichtigen, die aus praktischer Sicht häufig als ausschlaggebend empfunden werden. Es ist offensichtlich nicht erforderlich, die Transaktionskosten exakt zu quantifizieren, um zu transaktionskostentheoretisch begründeten Lösungen für das auch organisatorische Problem der optimalen Produktionstiefe zu gelangen.
Literatur:
Alchian, A. A./Demsetz, H. : Production, Information Costs, and Economic Organization, in: AER, 1972, S. 777 – 795
Aoki, M./Gustafsson, B./Williamson, O. E. : The Firm as a Nexus of Treaties, London et al. 1990
Cheung, S.N. S. : The Contractual Nature of the Firm, in: Journal of Law and Economics, 1983, S. 1 – 21
Coase, R. : The Nature of the Firm, in: Economica, 1937, S. 386 – 405
Commons, J. R. : Legal Foundations of Capitalism, New York 1924
Commons, J. R. : Institutional Economics, in: AER, 1931, S. 648 – 657
Fama, E. : Agency Problems and the Theory of the Firm, in: Journal of Political Economy, 1980, S. 288 – 307
Furubotu, E. G./Richter, R. : The New Institutional Economics, Tübingen 1991
Gerhard, T./Nippa, M./Picot, A. : Die Optimierung der Leistungstiefe, in: HarvMan, 1992, S. 136 – 142
Hax, H. : Theorie der Unternehmung, in: Betriebswirtschaftslehre und ökonomische Theorie, hrsg. v. Ordelheide, D./Rudolph, B./Büsselmann, E., Stuttgart 1991, S. 51 – 72
Macneil, I. R. : Contracts: Adjustment of Long-Term Economic Relations under Classical, Neoclassical and Relational Contract Law, in: Northwestern University Law Review, 1978, S. 854 – 905
Maher, M. E. : Transaction Cost Economics and Contractual Relations, Working Paper No. 72, Center of Economic Studies, Universtität München, München 1994
Männel, W. : Eigenfertigung und Fremdbezug, 2. A., Stuttgart 1981
March, J. G./Simon, H. : Organizations, 2. A., Cambridge/Mass. et al. 1993
Milgrom, P./Roberts, J. : Economics, Organization and Management, Englewood Cliffs/N.J. 1992
Picot, A. : Ein neuer Ansatz zur Gestaltung der Leistungstiefe, in: ZfbF, 1991, S. 336 – 357
Porter, M. E. : Wettbewerbsstrategie: Methoden zur Analyse von Branchen und Konkurrenten, 5. A., Frankfurt a.M. et al. 1988
Richter, R. : Institutionenökonomische Aspekte der Theorie der Unternehmung, in: Betriebswirtschaftslehre und ökonomische Theorie, hrsg. v. Ordelheide, D./Rudolph, B./Büsselmann, E., Stuttgart 1991, S. 395 – 429
Williamson, O. E. : The Economic Institutions of Capitalism, New York et al. 1985
Williamson, O. E. : Die ökonomischen Institutionen des Kapitalismus. Unternehmen, Märkte, Kooperationen, Tübingen 1990
Wolff, B. : Organisation durch Verträge, München 1994
|