|
Vertrauen
Inhaltsübersicht
I. Begriffliche Differenzierungen
II. Theoretische Perspektiven
III. Die Bedeutung von Vertrauen für die Organisationslehre
I. Begriffliche Differenzierungen
Der in der Betriebswirtschaftslehre verwendete Vertrauensbegriff lässt sich insgesamt als relativ facettenreich charakterisieren. Innerhalb der managementtheoretischen Vertrauensdiskussion, die seit Mitte der 1990er-Jahre eingesetzt und zu einer explosionsartigen Zunahme von Veröffentlichungen zu dieser Thematik geführt hat, wird deshalb immer häufiger eine kohärentere Begriffsverwendung von Vertrauen angemahnt (Bigley, Greogory/Pearce, Jone 1998; McEvily, Bill/Perrone, Vincenzo/Zaheer, Akbar 2003).
In der neueren Debatte lässt sich dennoch ein grundsätzlicher Konsens dahingehend konstatieren, dass Vertrauen als Beziehungsphänomen zwischen spezifischen Organisationen oder Personen konzipiert wird. Von daher setzt Vertrauen Interaktion und damit handlungsfähige Subjekte voraus. Interaktionsfähigkeit haben typischerweise Personen, sie wird aber auch Organisationen (verstanden im institutionellen Sinne) zugeschrieben. Hat man Personen als Interaktionspartner vor Augen, werden die Begriffe persönliches, zwischenmenschliches oder interpersonales Vertrauen gewählt. Handelt es sich hingegen um Organisationen, wird von inter-organisationalem Vertrauen, zum Teil auch etwas missverständlich von Systemvertrauen (das im Sinne von Zuversicht verwendet wird) gesprochen.
Versucht man die unterschiedlichen Begriffskonnotationen weiter zu präzisieren, so ist eine Unterscheidung zwischen Vertrauensbereitschaft, Vertrauenswürdigkeit und Vertrauen hilfreich. Vertrauensbereitschaft beschreibt die Einstellungsebene. Dabei kann es sich um eine spezifische Einstellung gegenüber einer konkreten Person handeln oder um eine generalisierte Vertrauensbereitschaft, die relativ unabhängig von spezifischen Vorerfahrungen allein aufgrund des gegebenen sozialen Kontextes (Gruppe, Organisation) vorhanden ist. Vertrauenswürdigkeit hingegen zielt auf die Einschätzung einer anderen Person oder Gruppe. Vertrauen beschreibt dann eine besondere Beziehungsqualität, die von den Interaktionspartnern als solche beobachtet wird.
Des Weiteren ist es sinnvoll, zwischen Zuversicht und Vertrauen zu differenzieren. Mit der Referenz „ Zuversicht “ wird lediglich eine Erwartung beschrieben, dass ein bestimmter Zustand zukünftig eintritt. Dies entspricht weitgehend dem „ Vertrauen “ in abstrakte Systeme, auf das insb. die soziologische Diskussion fokussiert (Luhmann, Niklas 1989; Giddens, Anthony 1990). Zuversicht ist von ubiquitärer Natur, so dass ohne dieses (etwa in die Akzeptanz von Geld als Zahlungsmittel) die Teilhabe an der modernen Gesellschaft nicht möglich wäre. Vertrauen dagegen ist spezifisch angelegt und wird in der betriebswirtschaftlichen Literatur häufig als eine positive Erwartungshaltung beschrieben, die sich entweder auf die Kompetenz ( „ competence trust “ ) oder die Handlungsintention ( „ goodwill trust “ ) des Interaktionspartners bezieht (Eberl, Peter/Kabst, Rüdiger 2001; Das, T. K./Teng, Bing-Sheng 2001). Während Ersteres das Vertrauen in „ technisch “ kompetente Rollenausübung beschreibt, zielt die zweite Form des Vertrauens auf die moralische Verpflichtung und Verantwortung des Interaktionspartners, eigene Interessen im Zweifel zurückzustellen. „ Competence trust “ stellt auf Leistungsrisiken ( „ performance risks “ ) ab, wohingegen sich „ goodwill trust “ auf Beziehungsrisiken ( „ relational risks “ ) bezieht (Das, T. K./Teng, Bing-Sheng 2001).
Vertrauen im Sinne von „ goodwill trust “ wird in der neueren organisationstheoretischen Vertrauensdiskussion verstärkt zugrunde gelegt (Mayer, Roger/Davis, James/Schoormann, David 1995, Rousseau, Denise 1998; McEvily, Bill/Perrone, Vincenzo/Zaheer, Akbar 2003). Im Falle des „ goodwill trust “ verlassen sich die Interaktionspartner auf eine nicht-opportunistische Handlungsintention beim Gegenüber (Nooteboom, Anthony 2002). Sie unterstellen damit, dass beim jeweils anderen Interaktionspartner keine Opportunismusneigung im Kontext der spezifischen Interaktionsbeziehung vorhanden ist. Die Handlungsintention ist für den Vertrauensfall deshalb von Relevanz, weil Vertrauen insbesondere in Situationen zum Tragen kommt, die durch ein besonderes Maß an Unsicherheit (Williamson, Oliver 1993) oder allgemeiner Kontingenz (Giddens, Anthony 1990) gekennzeichnet sind, sodass die Handlungen der Interaktionspartner ein gewisses Risiko beinhalten. Als konstitutiv für Vertrauensbeziehungen werden nämlich riskante Vorleistungen (Luhmann, Niklas 1989) oder einseitige Ressourcentransfers (Coleman, James 1991) betrachtet. Ein solches Engagement geht mit der Erwartung an den Interaktionspartner einher, die Vorleistung nicht in opportunistischer Weise auszunutzen. Vor diesem Hintergrund ist es irreführend, wie Williamson treffend argumentiert, eine sichere Erwartung, die auf der Androhung von Sanktionen ( „ deterrence-based trust “ ) oder sonstigen Sicherheiten basiert, als Vertrauen zu charakterisieren.
II. Theoretische Perspektiven
Die unterschiedlichen theoretischen Perspektiven des Vertrauens unterscheiden sich v.a. in ihrem Erklärungsbeitrag hinsichtlich der Entstehung von Vertrauensbeziehungen. Grundsätzlich lassen sich drei Richtungen herauskristallisieren: 1. kalkulatorische, 2. persönlichkeitstheoretische und 3. interaktionistische Ansätze.
1. Kalkulatorische Ansätze
Die Verfechter eines kalkülbasierten Vertrauens gehen davon aus, dass Vertrauen auf einer rationalen Individualentscheidung beruht. Vertrauensentscheidungen sind dabei grundsätzlich dadurch charakterisiert, dass die möglichen Verluste des Entscheidungsträgers (Vertrauensgebers) höher sind als die Gewinne. In dieser Konstellation gibt die vorab zuverlässig eingeschätzte und mit möglichen Verlusten und Gewinnen verrechnete Vertrauenswürdigkeit des Interaktionspartners und damit die Handlungsintention den Ausschlag für die Vertrauensentscheidung. Der grundlegendste Ansatz in der kalkulatorischen Perspektive wird von Coleman im Rahmen seiner Sozialtheorie vorgelegt. Die Entstehung von Vertrauen wird von ihm als „ Entscheidung unter Risiko “ behandelt. Formallogisch lässt sich das Kalkül nach Coleman wie folgt darstellen: Vertrauen wird immer dann gewährt, wenn

oder umgeformt

gegeben ist (Coleman, James 1991, S. 126).
Dabei bezeichnet (p) die Gewinnchance, also die Wahrscheinlichkeit, dass der Treuhänder (Vertrauensnehmer) sich vertrauenswürdig verhält, und entsprechend (1-p) die Verlustchance. Der mögliche Verlust (L) beschreibt den Schaden, wenn sich der Treuhänder als nicht vertrauenswürdig erweisen sollte. Der mögliche Gewinn (G) entsteht, wenn er vertrauenswürdig ist. Um das Kalkül einfach zu halten, wird allerdings ein entscheidender Punkt, nämlich der Einfluss der Handlungen des Vertrauensgebers auf die Vertrauensbereitschaft des Treuhänders von Coleman nicht berücksichtigt.
Aufbauend auf Überlegungen von Coleman wird insb. in der deutschen Betriebswirtschaftslehre im Rahmen der Neuen Institutionenökonomie versucht, Vertrauensbeziehungen als Prinzipal-Agenten-Beziehung zu begreifen (Sjurts, Insa 1998; Ripperger, Tanja 1998). Die hier zugrunde gelegte einfache Berechenbarkeit von Vertrauen wird allerdings u.a. von Williamson vehement kritisiert (Williamson, Oliver 1993). Darüber hinaus impliziert Vertrauen ein zur Opportunismusannahme der Neuen Institutionenökonomie gegenläufiges Menschenbild.
Prinzipiell der kalkulatorischen Richtung zuzurechnen sind auch spieltheoretische Modellierungen. Allerdings rückt die stärker verhaltenswissenschaftlich orientierte Spieltheorie weit weniger das konkrete Kalkül, sondern vielmehr das soziale Dilemma und damit die Struktur des Vertrauensproblems in den Vordergrund (Güth, Werner/Kliemt, Hartmut 1993; Deutsch, Morton 1958). Zudem wird das Vertrauensproblem nicht aus der Perspektive eines singulären Entscheidungsträgers betrachtet, sondern es werden interdependente Entscheidungen zugrunde gelegt. Damit kann der Beziehungscharakter von Vertrauen potenziell eingefangen werden. Bei der Modellierung des Vertrauensspiels wird i.d.R. von sequenzieller Interdependenz ausgegangen. Abb. 1 zeigt die Grundlogik eines auf sequenzieller Interdependenz beruhenden Vertrauensspiels in der sog. extensiven Form.
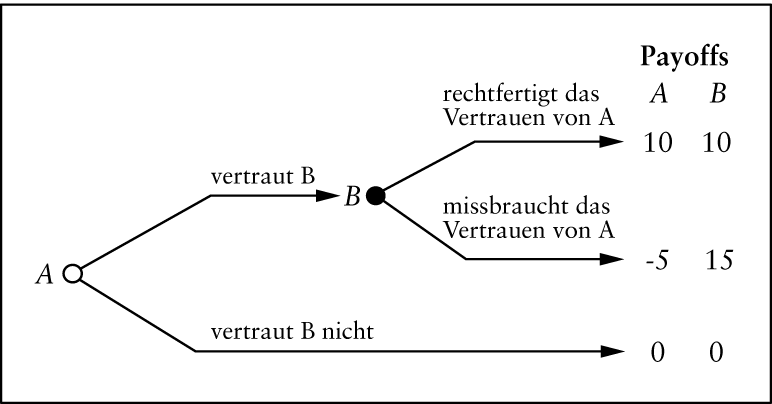
Abb. 1: Das Vertrauensspiel (nach Kreps, David 1990, S. 100)
Die Modellierung entspricht einer typischen „ moral hazard “ -Situation: Spieler A muss für die Transaktion in Vorleistung treten und Spieler B kann die Situation zu seinen Gunsten ausnutzen. Die Standardlösung wäre eine vertraglich geregelte ex ante Absicherung von A (z.B. der Einsatz von Pfändern). Die außervertragliche, auf Vertrauen basierende Lösung hängt nach Kreps mit Reputationseffekten zusammen. Sind mehrere Spieler A vorhanden, die als potenzielle Transaktionspartner von Spieler B in Frage kommen, verändert sich die Situation für Spieler B. Er muss darauf achten, dass seine Reputation entsprechend hoch ist, um an zukünftigen Transaktionen teilnehmen zu können. Je mehr potenzielle Spieler B zur Verfügung stehen, desto besser muss aufgrund der Konkurrenzsituation die Reputation des einzelnen Spielers B sein. Es entwickelt sich sozusagen ein Kampf um Reputation, da bei entsprechender Reputation Transaktionskosten eingespart werden können. Daher liegt es auch im Interesse von B, dass seine Handlung in Bezug auf die Rechtfertigung von Vertrauen von Spieler A beobachtbar (kontrollierbar) ist oder entsprechende Indikatoren auf das eigene Engagement hindeuten.
2. Persönlichkeitsorientierte Ansätze
Den Kontrapunkt zu den vorgestellten kalkülbasierten Ansätzen stellen die in der psychologischen Literatur vorherrschenden persönlichkeitstheoretischen Vertrauensmodelle dar, da sie von der Emotionsbasiertheit des Vertrauens ausgehen. Die unterstellte These ist, dass die in der Persönlichkeitsstruktur verankerte emotionale Vertrauensbereitschaft die zentrale Rolle für die Auftrittswahrscheinlichkeit vertrauensvollen Verhaltens spielt. Prominent ist dabei insb. die Annahme der Entstehung eines Ur-Vertrauens im frühesten Kindesalter, wie sie von Erikson aus entwicklungspsychologischer Sicht begründet wird (Erikson, Erik 1968). Die Grundlagen für vertrauensvolles Verhalten werden demnach bereits in der ersten Entwicklungsphase zu einer eigenen Persönlichkeit bzw. Identität gelegt. Eriksons Werk hat die psychologische Vertrauensforschung bis heute entscheidend beeinflusst.
Als zweiter Meilenstein innerhalb der persönlichkeitsorientierten Vertrauensforschung können die Arbeiten von Rotter gewertet werden (z.B. Rotter, Julian 1967). Er konzeptualisiert die Vertrauensbereitschaft als generalisierte Erwartung einer Person, die aufgrund sozialer Lernprozesse erworben wurde. Rotter bemüht sich dabei wesentlich um eine Operationalisierung der Vertrauensbereitschaft. Dazu entwickelt er einen entsprechen Fragebogen, die „ Interpersonal Trust Scale “ . Obwohl es bereits vor Rotter ähnlich angelegte empirische Studien zum Vertrauen anhand von Persönlichkeitstests mit Hilfe von Fragebogen gab, hat gerade er die empirisch angelegte psychologische Persönlichkeitsforschung zum Vertrauen vorangetrieben. Seine Vertrauensskala dient bis heute als wesentliche Grundlage für entsprechende empirische Untersuchungen zur Vertrauensbereitschaft einer Person.
Die persönlichkeitspsychologische Herangehensweise an das Vertrauensphänomen kann die Diskussion entscheidend bereichern. Allen Vorstellungen, die davon ausgehen, dass Vertrauen bei Bedarf relativ leicht hergestellt oder kalkuliert eingesetzt werden kann, werden eindeutige Grenzen gesetzt. Im Kern besagen die persönlichkeitstheoretischen Vertrauenstheorien nämlich, dass die jeweilige individuelle Vertrauensbereitschaft als generalisierte, von der spezifischen Situation unabhängige Disposition die entscheidende Rolle für das Zustandekommen einer konkreten Vertrauensbeziehung spielt. Es ist also in erster Linie nicht nur die Vertrauenswürdigkeit des potenziellen Partners, sondern die eigene emotionale Bereitschaft, sich generell auf Vertrauensbeziehungen einzulassen.
3. Interaktionistische Ansätze
Quer zu den beiden ersten Ansätzen liegt die interaktionistische Erklärung der Vertrauensentstehung. Die Vertrauensentstehung wird nicht in erster Linie an die Dispositionen oder das Kalkül der beteiligten Person gekoppelt, sondern an die spezifische Interaktionsdynamik. Vertrauen wird konsequent als Beziehungsphänomen behandelt und sagt etwas über den sozialen Zusammenhalt der Interaktionspartner aus.
Einen zentralen Erklärungsbeitrag bietet dabei die neuere Attributionstheorie (Eberl, Peter 2003, S. 185 ff.). Durch den Rückgriff auf Attributionsprozesse wird zunächst ganz allgemein auf den Umstand fokussiert, dass sich die Interaktionspartner alltagsweltlich als naive Psychologen betätigen, und von daher beobachtete Verhaltensweisen im Hinblick auf mögliche Ursachen hinterfragt werden (Heider, Fritz 1958). Die neuere attributionstheoretische Forschung geht davon aus, dass neben den traditionellen zwei Faktoren „ Personen “ und „ Umwelt “ ein dritter Kausalfaktor nämlich „ Beziehungsqualität “ eine zentrale Rolle spielt (Kelley, Harold et al. 1983). Vertrauen lässt sich vor diesem Hintergrund als Attribution in Bezug auf die Beziehungsqualität bezeichnen, die aufgrund entsprechender Indizien vorgenommen wird.
So geht die Attribution „ Vertrauen “ einher mit der Attribution einer emotional bedingten intrinsischen Beziehungsmotivation; die Beziehung sorgt als solche für emotionale Zufriedenheit. Handlungen des Interaktionspartners, bei denen eine Tauschabsicht unterstellt wird, führen hingegen zu Attributionen einer instrumentellen und nicht vertrauensbasierten Beziehungsqualität. Vor diesem Hintergrund ist es irreführend, davon auszugehen, dass andere Beziehungsformen entweder einen notwendigen Vorläufer von Vertrauen darstellen oder die Qualität von Vertrauensbeziehungen sich anhand eines Stufenmodells entwickelt (Rempel, John/Holmes, John/Zanna, Mark 1985).
III. Die Bedeutung von Vertrauen für die Organisationslehre
Aus der Kritik am Bürokratiemodell hat sich im Zuge des Human-Ressourcen-Ansatzes erstmalig die Frage nach der Vertrauensbasiertheit von Managementinstrumenten insb. von Organisationsstrukturen gestellt. Nur wer den Mitarbeitern Vertrauen entgegenbringt, so lässt sich McGregor, einer der frühen Hauptvertreter des Human-Ressourcen-Ansatzes auslegen, kann auf entsprechende Kontrollmaßnahmen verzichten und wird durch erhöhtes Engagement belohnt (McGregor, Douglas 1960). In der neueren Diskussion wird Vertrauen als Substitut für hierarchische Kontrolle verhandelt, so wird Vertrauen neben Preis und hierarchischer Anweisung als dritter möglicher Koordinationsmechanismus beschrieben (Ring, Peter/Van de Ven, Andrew 1992; Bradach, Jeffrey/Eccles, Robert 1989). In Bezug auf soziale Kontrolle wird hingegen eher von einem supplementären Verhältnis ausgegangen (Das, T. K./Teng, Bing-Sheng 1998).
Die Gegenüberstellung von Vertrauen und Kontrolle findet in der Diskussion um neue Organisations- bzw. Kooperationsformen, die häufig mit dem Netzwerkbegriff belegt werden, ihren Ausdruck. So wird für inter-organisationale Netzwerke nicht mehr einfach der Hybridcharakter zwischen Markt und Hierarchie, sondern vielmehr die eigenständige spezifische Form betont, die dadurch gekennzeichnet ist, dass das besondere Spannungsfeld zwischen Autonomie und Abhängigkeit der Netzwerkmitglieder durch Vertrauen bewerkstelligt wird (Powell, Walter 1990; Sydow, Jörg 1998). Auch für organisationsinterne Netzwerkstrukturen wird dem Vertrauen zwischen Netzwerkeinheiten oder Organisationsmitgliedern eine zentrale Bedeutung zugewiesen (z.B. Creed, Douglas/Miles, Raymond 1996). In eine ähnliche Richtung weist das von Ouchi zu Beginn der 1980er Jahre mit starken Querbezügen zur Unternehmenskulturdebatte in die Diskussion eingebrachte Konzept der vertrauensbasierten Clan-Organisation (Ouchi, William 1980). Darüber hinaus wird Vertrauen auch im Zusammenhang mit persönlichen Netzwerken diskutiert. Diese werden häufig unter dem Schlagwort „ social capital “ verhandelt, mit der Unterstellung, dass soziale Beziehung einen Wert, also Kapital, und damit einen organisationalen Vorteil darstellen können (Nahapiet, Janine/Ghoshal, Sumantra 1998).
Betrachtet man die hier kurz skizzierte Diskussion aus der Perspektive der Organisationsgestaltung, so ist zu präzisieren, dass Vertrauen v.a. eine effiziente Lösung des Integrationsproblems verspricht, selbst aber keinen eigenständigen Koordinationsmechanismus darstellt. Die Koordinationsform, die man letztlich vor Augen hat, ist die spontane Selbstabstimmung (Schreyögg, Georg 2003, S. 174 f.). Das Neue an der Netzwerkidee ist aus organisationstheoretischer Sicht, dass spontane Selbstabstimmung nicht bloß als etwaige Dysfunktionalität der Hierarchie ausgleichender Mechanismus verstanden wird, sondern als dominierende Abstimmungsform in den Mittelpunkt rückt. Das Risiko ineffizienter Koordination ist bei dieser Abstimmungsform allerdings besonders hoch, da die Gefahr besteht, dass notwendige übergreifende Koordinationsmaßnahmen erst gar nicht ergriffen werden, die Akteure mit der Abstimmung überfordert sind oder die Autonomie gezielt missbraucht wird. Für eine effiziente Selbstabstimmung muss nämlich vorausgesetzt werden, dass die vorhandene Autonomie konstruktiv und eigeninitiativ im Hinblick auf die kollektive Zielerreichung eingesetzt wird. Insofern lässt sich eine Lösung des Integrationsproblems über spontane Selbstabstimmung nur in Kombination mit einer Lösung des Motivationsproblems erreichen. Wechselseitiges Vertrauen verspricht eine Motivation im Hinblick auf die Erreichung gemeinsamer Ziele. Insofern dürften spontane Selbstabstimmungsprozesse v.a. dann effizient sein, wenn sie vertrauensbasiert sind. Vor diesem Hintergrund stellt sich Vertrauen als entscheidende Moderatorvariable für funktionale spontane Selbstabstimmungsprozesse dar.
Die vermuteten positiven Motivationseffekte von Vertrauen werden durch zahlreiche empirische Studien untermauert. In ihrer Meta-Analyse von 45 empirischen Studien kommen Dirks und Ferrin zu dem Ergebnis, dass Vertrauensbeziehungen v.a. zu höherer Arbeitszufriedenheit und stärkerem Commitment gegenüber der Organisation führen und damit indirekt die Koordinationseffizienz durch verbesserten Informationsaustausch und kooperatives Verhalten steigern (Dirks, Kurt/Ferrin, Donald 2001). Die verschiedenen Wirkungsanalysen zu Vertrauen vermitteln unter dem Strich das ziemlich eindeutige Bild, dass vorhandene Vertrauensbeziehungen die Qualität individueller und kollektiver Leistungen verbessern. Vor diesem Hintergrund wird Vertrauen sogar als strategischer Wettbewerbsvorteil betrachtet (Barney, Jay/Hansen, Mark 1994). Kritisch anzumerken ist allerdings, dass Vertrauen als unabhängige Variable jeweils vorausgesetzt werden muss, diese aber nicht einfach als Ausgangsbedingung erzeugt werden kann. Insofern wäre bei den Wirkungsanalysen zu Vertrauen differenziert zu überprüfen, anhand welcher Indikatoren das Vorhandensein von Vertrauensbeziehungen unterstellt wird.
Dieser Punkt verweist auch auf das zentrale Problem aus gestalterischer Sicht, denn der Erfolgsfaktor „ Vertrauen “ lässt sich nicht einfach herstellen oder einsetzen. Vertrauensbeziehungen können nicht institutionalisiert werden. Sie sind Ausfluss informeller Prozesse in Organisationen. Bestenfalls lassen sich die Rahmenbedingungen in Richtung einer erhöhten Vertrauensbereitschaft verbessern.
Literatur:
Barney, Jay/Hansen, Mark : Trustworthiness as a source of competitive advantage, in: SMJ, Jg. 15, 1994, S. 175 – 190
Bigley, Gregory/Pearce, Jone : Straining for Shared Meaning: Problems of Trust and Distrust, in: AMR, Jg. 23, 1998, S. 405 – 421
Bradach, Jeffrey/Eccles, Robert : Price, authority, and trust. From ideal types to plural forms, in: Annual Review of Sociology, Jg. 15, 1989, S. 97 – 118
Coleman, James : Grundlagen der Sozialtheorie, Bd. 1: Handlungen und Handlungssysteme, München 1991
Creed, Douglas/Miles, Raymond : Trust in organizations: A conceptual framework linking organizational forms, managerial philosophies, and the opportunity cost of control, in: Trust in Organizations, hrsg. v. Kramer, Roderick/Tyler, Tom, Thousand Oaks 1996, S. 16 – 38
Das, T. K./Teng, Bing-Sheng : Trust, Control, and Risk in Strategic Alliances: An Integrated Framework. In: Organization Studies Jg. 22, 2001, S. 251 – 283
Das, T. K./Teng, Bing-Sheng : Between trust and control. Developing confidence in partner cooperation in alliances, in: AMR, Jg. 23, 1998, S. 491 – 512
Deutsch, Morton : Trust and suspicion, in: Journal of Conflict Resolution, Jg. 2, 1958, S. 265 – 279
Dirks, Kurt/Ferrin, Donald : The role of trust in organizational settings, in: Org.Sc., Jg. 12, 2001, S. 450 – 467
Eberl, Peter : Vertrauen und Management, Stuttgart 2003
Eberl, Peter/Kabst, Rüdiger : : Vertrauen, Opportunismus und Kontrolle. Eine empirische Analyse von Joint Venture Beziehungen vor dem Hintergrund der Transaktionskostentheorie, in Managementforschung, Jg. 15, 2005, S. 239 – 275
Erikson, Erik : Identitiy – youth and crisis, New York 1968
Giddens, Anthony : Consequences of Modernity, Oxford 1990
Güth, Werner/Kliemt, Hartmut : Menschliche Kooperation basierend auf Vorleistungen und Vertrauen, in: Jahrbuch für neue politische Ökonomie, hrsg. v. Herder-Dornreich, Philipp/Schenk, Karl/Schmidtchen, Dieter, Tübingen 1993, S. 253 – 277
Heider, Fritz : The psychology of interpersonal relations, New York 1958
Kelley, Harold : Analyzing close relationships, in: Close Relationships, hrsg. v. Kelley, Harold et al., New York 1983, S. 20 – 67
Kreps, David : Corporate culture and economic theory, in: Perspectives on positive political economy, hrsg. v. Alt, James/Shepsle, Kenneth, Cambridge 1990, S. 90 – 143
Luhmann, Niklas : Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität, 3. A., Stuttgart 1989
Mayer, Roger/Davis, James/Schoorman, David : An integrative model of organizational trust, in: AMR, Jg. 20, 1995, S. 709 – 734
McEvily, Bill/Perrone, Vincenzo/Zaheer, Akbar : Trust as an organizing principle, in: Org.Sc., Jg. 14, 2003, S. 91 – 103
McGregor, Douglas : The human side of enterprise, New York 1960
Nahapiet, Janine/Ghoshal, Sumantra : Social capital, intellectual capital and the organizational advantage, in: AMR, Jg. 23, 1998, S. 242 – 266
Noteboom, Bart : Trust, Forms, Foundations, Functions, Failures and Figures. Cheltenham 2002
Ouchi, William : Markets, bureaucracies and clans, in: ASQ, Jg. 25, 1980, S. 129 – 141
Powell, Walter : Neither market nor hierarchy. Network forms of organizations, in: ROB 12, hrsg. v. Staw, Barry M./Cummings, Larry L., Greenwich 1990, S. 295 – 326
Rempel, John/Holmes, John/Zanna, Mark : Trust in close relationships, in: JPSP, Jg. 49, 1985, S. 95 – 112
Ring, Peter/Van de Ven, Andrew : Structuring cooperative relationships between organizations, in: SMJ, Jg. 13, 1992, S. 483 – 498
Ripperger, Tanja : Ökonomik des Vertrauens. Analyse eines Organisationsprinzips, Tübingen 1998
Rotter, Julian : A new scale for the measurement of interpersonal trust, in: Journal of Personality, Jg. 35, 1967, S. 651 – 665
Rousseau, Denise : Not so different after all: A cross-discipline view of trust. Introduction to special topic forum, in: AMR, Jg. 23, 1998, S. 393 – 404
Schreyögg, Georg : Organisation. Grundlagen moderner Organisationsgestaltung, 4. A., Wiesbaden 2003
Sjurts, Insa : Kontrolle ist gut, ist Vertrauen besser? Ökonomische Analysen zur Selbstorganisation als Leitidee neuer Organisationskonzepte, in: DBW, Jg. 58, 1998, S. 283 – 298
Sydow, Jörg : Understanding the constitution of interorganizational trust, in: Trust within and between organizations, hrsg. v. Lane, Christel/Bachmann, Reinhard, Oxford 1998, S. 31 – 63
Williamson, Oliver : Calculativeness, trust and economic organization, in: Journal of Law and Economics, Jg. 36, 1993, S. 453 – 486
|