|
Risiko und Ungewissheit
Inhaltsübersicht
I. Verschiedene Informationsstände über die Realität
II. Entscheidungen bei Risiko
III. Entscheidungen bei Ungewissheit
I. Verschiedene Informationsstände über die Realität
1. Vorbemerkungen
Entscheidungen bei Sicherheit sind relativ unproblematisch, es sei denn, die Konsequenzen der Entscheidungen betreffen mehrere Ziele, mehrere Zeitpunkte, mehrere Personen u. dgl. Bezeichnet man die Nichtexistenz von Sicherheit mit Unsicherheit, so kann man ein breites Spektrum an Unsicherheitssituationen unterscheiden. Von besonderem Interesse sind die beiden Fälle Risiko und Ungewissheit. Eine Risikosituation ist dadurch charakterisiert, dass (subjektive oder objektive) Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten der verschiedenen Zustände der Realität bekannt sind. Bei einer Ungewissheitssituation liegen dagegen per definitionem keinerlei Informationen bezüglich der Zustandswahrscheinlichkeiten vor. Dass zwischen diesen polaren Fällen des Risikos und der Ungewissheit viele Mischformen denkbar sind, soll der nachfolgende Abschnitt 2 verdeutlichen. Allen Unsicherheitssituationen (Risiko, Ungewissheit, Mischformen) ist gemeinsam, dass Entscheidungen auch dann problematisch sind, wenn die eingangs erwähnten Komplikationen fehlen, d.h. nur ein Entscheidungsträger, eine Zeitperiode, ein Ziel usw. relevant sind. Die Erörterung dieser Probleme sowie markanter Lösungsvorschläge erfolgt in den Hauptkapiteln II. (Entscheidungen bei Risiko) und III. (Entscheidungen bei Ungewissheit). Vorab soll der in den beiden Kapiteln benötigte und oben schon erwähnte Begriff „ Zustand der Realität “ noch etwas verdeutlicht werden. Eine vollständige Beschreibung der Realität ist natürlich unmöglich und für entscheidungstheoretische Zwecke auch nicht erforderlich.
Im finanz- und bankwirtschaftlichen Kontext können die Zustände z1,z2,? beispielsweise die zukünftigen Werte eines Aktienkurses, eines Zinssatzes, des DAX oder auch die Anzahl nachgefragter Kredite bedeuten. Berücksichtigt man bei den Kurs- und Zinsdaten nur zwei Nachkommastellen, so besteht der Zustandsraum Z, d.h. die Menge aller relevanten Zustände, aus einer endlichen oder diskreten Menge
Z = {z1,z2,?}.
Häufig ist es zweckmäßig, eine diskrete (aber aus vielen Elementen bestehende) Menge als ein Kontinuum aufzufassen; Z ist dann ein Intervall, die positive Halbachse oder die ganze reelle Achse. Der „ kleinste “ Zustandsraum, der für Unsicherheitssituationen von Bedeutung ist, besteht aus zwei Elementen, beispielsweise
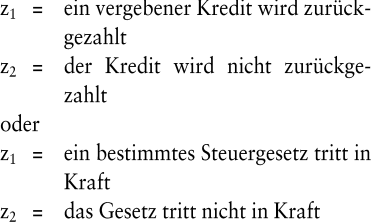
Die (im Falle einer Risikosituation bekannten) Zustandswahrscheinlichkeiten bezeichnen wir mit p1,p2,?, wobei
pi = P (Zustand zi tritt ein).
Im Falle eines kontinuierlichen Zustandsraumes ist anstelle der Zustandswahrscheinlichkeiten natürlich eine Wahrscheinlichkeitsdichte zu verwenden.
2. Mischformen zwischen Risikosituationen und Ungewissheitssituationen
Mischformen entstehen, wenn Zustandswahrscheinlichkeiten nur unzureichend bekannt sind. Dies kann mehrere Ursachen haben. Betrachten wir zur Erläuterung der ersten Ursache einen zweielementigen Zustandsraum Z = {z1,z2} wie etwa im Kreditnehmer-Beispiel des vorangegangenen Abschnitts. Ist hierfür nur bekannt, dass der Zustand z1 mindestens so wahrscheinlich wie der Zustand z2 ist, so liegt zwar eine verlässliche Angabe oder Restriktion p1 ≥ p2 bzgl. der Zustandswahrscheinlichkeiten vor. Die Angabe ist jedoch zu rudimentär, um die für eine Risikosituation benötigte Zustandsverteilung eindeutig festzulegen. So sind im Rahmen der Angabe beispielsweise die Zustandsverteilungen
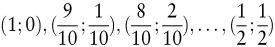
sowie (unendlich) viele weitere Verteilungen möglich. Das Analoge gilt auch bei Angaben vom Typus
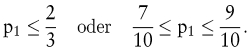
Bei mehr als zwei Zuständen wird die Vielfalt von denkbaren Restriktionen und damit verträglichen Zustandsverteilungen naturgemäß noch viel größer. Können alle Restriktionen in Form von linearen Gleichungen und Ungleichungen formuliert werden, so liegt eine lineare partielle Information (LPI) vor. (Wegen derartiger Modelle sei beispielsweise auf Kofler, E./Menges, G. 1976; Kofler, E. 1989; Bamberg, G./Coenenberg, A.G. 2000 verwiesen.)
Neben dem Vorliegen von handfesten aber zu rudimentären Informationen bzgl. der Zustandsverteilung sei noch eine weitere Ursache für Mischformen betrachtet. Sie liegt in den Schwierigkeiten begründet, die reale Entscheidungsträger mit der Wahrnehmung und Handhabung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen haben. So könnte (vielleicht aufgrund mangelnder Recherchen oder Phantasie) eine Gleichverteilung über alle Zustände für möglich erachtet werden, ohne dass der Entscheidungsträger sonderlich davon überzeugt ist, dass dies die „ wahre Zustandsverteilung “ ist. Dann liegt zwar eine eindeutige, gleichzeitig aber wenig vertrauenswürdige Zustandsverteilung vor. In der Entscheidungstheorie wurden auch hierauf zugeschnittene Entscheidungsregeln entwickelt, wie etwa die Hodges-Lehmann-Regel (vgl. Mag, W. 1990). An dieser Stelle könnte man sich zu Recht fragen, ob zwischen objektiven und subjektiven Wahrscheinlichkeiten nicht strenger unterschieden werden sollte. Objektive Wahrscheinlichkeiten treten bei klassischen Glücksspielen (Lotto, Roulette u. dgl.) auf und können mithilfe von Symmetrien, Annahmen über die Ordnungsmäßigkeit von Geräten usw. deduziert werden. Die meisten ökonomisch relevanten Situationen sind jedoch nicht von diesem Typus. Selbst in der Lebensversicherung, in der man es mit beeindruckend vielen empirischen Daten zu tun hat, ist es unmöglich, aufgrund der heutigen Sterbetafeln die objektiven Sterbewahrscheinlichkeiten für aktuell gewonnene Versicherungsnehmer zu deduzieren. In aller Regel sind die bei praxisrelevanten Entscheidungssituationen verwendeten Wahrscheinlichkeiten stets in einem mehr oder minder großen Maße subjektiv, auch wenn noch so viele empirische Daten oder Expertenmeinungen die Festlegung bzw. Schätzung der Wahrscheinlichkeiten stützen. Deshalb werden in der Entscheidungstheorie gleichermaßen subjektive wie objektive Wahrscheinlichkeiten benutzt.
Die mangelnde Verarbeitungskapazität von Wahrscheinlichkeiten durch reale Entscheidungsträger verursacht einen weiteren Effekt, der zu Mischformen Anlass gibt. Es handelt sich um den Ambiguitäts-Effekt, gemäß dem in verschiedenen Situationen, die vom wahrscheinlichkeitstheoretischen Standpunkt aus äquivalent sind, diejenigen bevorzugt werden, bei denen sich der Entscheidungsträger ein klareres Bild von den Wahrscheinlichkeiten machen kann. In einer experimentellen Untersuchung hat Weber (Weber, M. 1989) den Ambiguitäts-Effekt in Finanz- und Kapitalmärkten nachgewiesen.
3. Maßnahmen zur Verbesserung des Informationsstandes
Eine Verbesserung des Informationstandes erfordert im allgemeinen Zeit, Mühen und Geld. Mithilfe des Begriffs des Informationswertes, der in vielen entscheidungstheoretischen Lehrbüchern (z.B. Dinkelbach, W. 1982; Mag, W. 1990; Laux, H. 1998; Bamberg, G./Coenenberg, A.G. 2000) behandelt wird, kann man entscheiden, ob sich die (mit Kosten verbundene) Inanspruchnahme einer Informationsquelle lohnt oder nicht lohnt. Mit demselben Begriff kann man auch das Problem lösen, aus verschiedenen konkurrierenden Informationsquellen die beste herauszusuchen.
II. Entscheidungen bei Risiko
Im Gegensatz zu Kapitel I soll die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Zustände nicht weiter problematisiert werden. Interessanterweise treten nämlich die Schwierigkeiten, die mit verschiedenen Lösungskonzepten und Entscheidungsregeln verbunden sind, auch dann schon auf, wenn rein objektive, d.h. aus den Axiomen der Wahrscheinlichkeitstheorie ableitbare, Zustandswahrscheinlichkeiten gegeben sind. Dann ist auch für jede Aktion a,b,c,? eine Zufallsvariable Xa,Xb, Xc,? festgelegt, deren Realisation mit dem jeweiligen Ergebnis der Aktion bei dem realisierten Zustand identisch ist.
Aktion a → Zufallsvariable Xa
Zur Illustration sei beispielsweise die Aktion 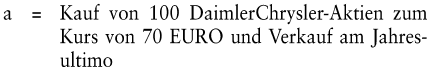
betrachtet. Vereinfachend werde ein vierelementiger Zustandsraum Z = {z1,z2,z3,z4} angenommen mit
z1/2/3/4 = Kassakurs am Ultimo ist 65, – /70, – /75, – /80, –
Die Zustandswahrscheinlichkeiten seien
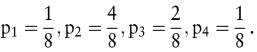
Schließlich sei als Ergebnis der Aktion der jeweilige Gewinn unter Vernachlässigung von Transaktionskosten und Steuern verstanden. Infolgedessen entspricht a der Zufallsvariablen Xa
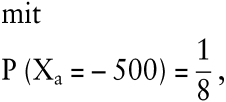
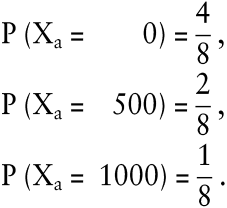
1. Klassische Entscheidungsprinzipien
Die Wahl zwischen zwei risikobehafteten Entscheidungen a und b entspricht also der Wahl zwischen den beiden zugehörigen Zufallsvariablen Xa und Xb. Die klassischen Entscheidungsprinzipien postulieren, dass für die Präferenz bzw. Indifferenz zwischen zwei Zufallsvariablen nicht die gesamte Wahrscheinlichkeitsverteilung, sondern nur einige wenige Verteilungskennzahlen maßgeblich sind. Spielt nur der Erwartungswert μ eine Rolle, so spricht man vom μ-Prinzip. Das prominenteste klassische Entscheidungsprinzip besagt jedoch, dass sowohl der Erwartungswert μ als auch die Standardabweichung σ für die Bestimmung der Rangfolge zwischen den Aktionen relevant sind. Dementsprechend heißt das Prinzip auch das (μ, σ)-Prinzip.
In Anbetracht der vielen weiteren denkbaren Verteilungsparameter (Median, Modalwert, Schiefe, Wölbung, Verlustwahrscheinlichkeit, Verlusterwartungswert, Semivarianz, Spannweite, Risikomaße, Minimum, Maximum usw.) sowie der Möglichkeit, diese allein zu betrachten, zu Gruppen von je zwei, je drei,? zusammenzufassen, erkennt man, dass es so viele klassische Entscheidungsprinzipien gibt, wie die Phantasie reicht. Hinzu kommt noch ein weiterer Spielraum für die Phantasie. Denn die Zugrundelegung eines klassischen Entscheidungsprinzips setzt nur einen Rahmen. Eine definitive Rangfolge der zur Debatte stehenden Aktionen erhält man erst, wenn genau festgelegt ist, wie die relevanten Verteilungsparameter zu einer Bewertungsziffer kombiniert werden. Erst diese letztere Festlegung macht aus dem Entscheidungsprinzip eine Entscheidungsregel. Betrachten wir dazu wieder das (μ,σ)-Prinzip und bezeichnen wir die gemäß der jeweiligen Entscheidungsregel gebildete Bewertungs- oder Güteziffer mit Φ(μ,σ), so sind beispielsweise Φ(μ,σ) = μ- 0,15 ·σ oder Φ(μ,σ) = μ – 0,03 ·σ2 denkbare Entscheidungsregeln. Gilt für die Ergebnisse der risikobehafteten Aktionen „ je größer, desto besser “ , was bei Renditen, Gewinnen, Endvermögen usw. zutrifft, so sollte eine plausible (μ,σ)-Regel die Eigenschaften haben, daß Φ(μ,σ) monoton mit μ steigt und mit σ fällt.
Die zweite Eigenschaft drückt Risikoaversion des Entscheidungsträgers aus. Beim Vergleich einer Zufallsvariablen X mit dem sicheren Ergebnis in Höhe von μ = E(X) präferiert er Letzteres: E(X) X.
Denn die sichere Alternative hat die Bewertungsziffer Φ(μ,0), wohingegen X nur die kleinere Bewertungsziffer Φ(μ,σ) besitzt. Obige (μ,σ)-Regeln erfüllen beide Plausibilitätsforderungen. Man wird sich häufig für das sichere Ergebnis s interessieren, sodass der Entscheidungsträger indifferent zwischen s und X ist: s ~ X. Dieses s bezeichnet man als Sicherheitsäquivalent von X. Risikoaversion liegt demnach vor, wenn das Sicherheitsäquivalent kleiner als E(X) ist; der Entscheidungsträger gibt sich mit einem Ergebnis zufrieden, das kleiner als der Erwartungswert ist. Gilt umgekehrt s > E(X), so bezeichnet man das Verhalten als risikofreudig. Gilt schließlich stets s = E(X), so liegt Risikoneutralität vor. In der Portfoliotheorie müssen risikofreudige (sowie risikoneutrale) Akteure aus folgendem Grunde ausgeklammert werden: Existieren beispielsweise eine risikobehaftete Anlagemöglichkeit mit einer erwarteten Rendite von 10% und ein risikofreier Zinssatz von 8% (zu dem beliebige Beträge ge- oder verliehen werden können), so würde ein risikofreudiger oder risikoneutraler Investor einen beliebig hohen Kredit aufnehmen und das Geld risikobehaftet anlegen. Es gäbe mithin weder eine optimale Kombination von risikobehafteter und risikofreier Anlage noch ein Kapitalmarktgleichgewicht. Bei risikoaversen Investoren existieren keine derartigen Probleme. Das optimale Portfolio kann im Prinzip einfach bestimmt werden; eine graphische Darstellung ist in Abb. 1 zu finden. In der Abbildung wurden ausschließlich risikobehaftete Portfolios berücksichtigt. Wegen der vielfältigen Ergänzungen (risikofreie Anlage, Leerverkäufe, differierender Soll- und Habenzins usw.) sei auf Standard-Lehrtexte zur Finanz- und Kapitalmarktheorie verwiesen (beispielsweise auf Uhlir, H./Steiner, P. 1994; Spremann, K. 1996; Kruschwitz, L. 1999; Franke, G./Hax, H. 1999; Perridon, /Steiner, 1999). 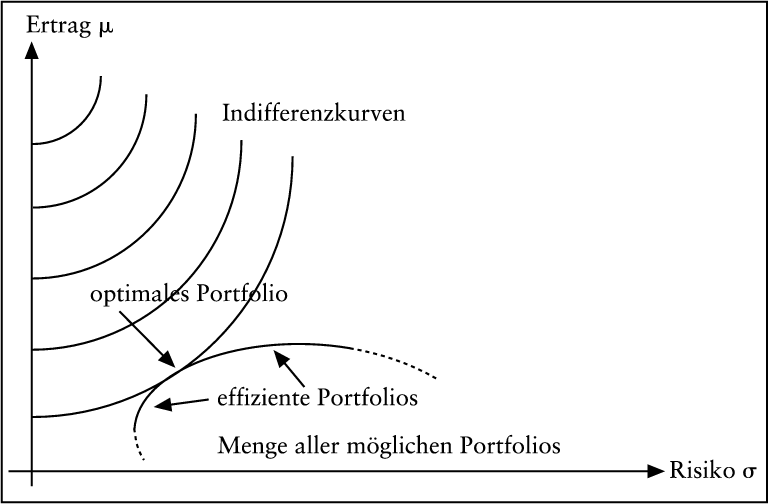
Abb. 1: Jedem Portfolio entspricht ein Punkt der (σ,μ)-Ebene. Der Tangentialpunkt der Effizienzkurve mit einer Indifferenzkurve bestimmt das optimale Portfolio.
2. Das Bernoulli-Prinzip
Bei der Diskussion der klassischen Entscheidungsregeln wurde auf den großen Spielraum (bzw. die Willkür) bei der Fixierung einer Regel hingewiesen. Trotz dieses Spielraumes ist jede der auswählbaren Entscheidungsregeln mit einer relativ großen Inflexibilität behaftet. So müssen bei einer (μ,σ)-Regel Ergebnisverteilungen zwangsläufig als gleichwertig gelten, wenn sie in Bezug auf diese beiden Parameter übereinstimmen. Man kann leicht Beispiele konstruieren, bei denen diese Indifferenz weder plausibel noch empirisch gestützt ist.
Das Bernoulli-Prinzip besitzt diesen Mangel an Flexibilität nicht, da es die Ergebnisverteilung in ihrer Gesamtheit einbezieht. Es ist nach Daniel Bernoulli benannt, der bereits 1738 zutreffend erkannt hatte, dass die alleinige Orientierung am Ergebniserwartungswert reales Verhalten nicht adäquat beschreibt und dass eine für den Entscheidungsträger typische Einstellung zum Risiko mit einbezogen werden muss. Das Bernoulli-Prinzip (im Englischen „ expected utility hypothesis “ ) besagt:
Es gibt für jeden Entscheidungsträger eine (auf der Menge aller Ergebnisse definierte und bis auf eine wachsende lineare Transformation eindeutige) Nutzenfunktion u mit der Eigenschaft, dass die verschiedenen Aktionen aufgrund des zugehörigen Nutzenerwartungswertes beurteilt werden.
Die nachfolgenden Bemerkungen sollen diese abstrakt wirkende Aussage kommentieren und verständlicher machen.
a) Sind Xa und Xb die zu den risikobehafteten Aktionen a und b gehörenden Zufallsvariablen, so besagt das Bernoulli-Prinzip
a ≻ b genau dann wenn E u(Xa) > E u(Xb),
a ~ b genau dann wenn E u(Xa) = E u(Xb);
d.h. die Bewertungsfunktion Φ, die jeder Aktion a eine Güteziffer zuordnet, besitzt beim Bernoulli-Prinzip die Form
Φ(a) = E u(Xa).
b) Betrachten wir beispielsweise die eingangs dieses Kapitels präzisierte Aktion a (= Kauf von 100 DaimlerChrysler-Aktien und Verkauf zum Jahresultimo), so bestimmt sich der Nutzenerwartungswert gemäß
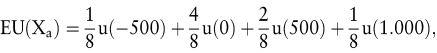
was sich bei konkret gegebener Funktion u unschwer als reelle Zahl ausrechnen lässt.
c) Die im Vergleich zu den klassischen Entscheidungsprinzipien erhöhte Flexibilität entsteht dadurch, dass jedes einzelne Ergebnis x in eine (subjektive) Größe u(x) transformiert werden kann. Es mag der Verdacht aufkommen, dass es sich beim Bernoulli-Prinzip infolge dieser großen Flexibilität um ein tautologisches Konzept handeln könnte. Dass dies nicht der Fall ist, zeigen Beispiele, bei denen die vom Entscheidungsträger geäußerte Präferenz zwischen risikobehafteten Aktionen dem Bernoulli-Prinzip widersprechen kann. Geht man andererseits von der Gültigkeit des Bernoulli-Prinzips aus, so lässt sich aus dem Verhalten von Entscheidungsträgern in sehr einfach strukturierten Entscheidungssituationen die Funktion u empirisch ermitteln. Wegen Details sei auf die Literatur verwiesen (beispielsweise auf Bitz, M. 1981; Schneeweiß, Ch. 1991; Bamberg, G./Coenenberg, A.G. 2000).
d) Das Bernoulli-Prinzip kann aus einigen Rationalitätspostulaten (für die Präferenzordnung zwischen den Zufallsvariablen) gefolgert werden. Einige Postulate sind vom normativen Standpunkt aus sehr natürlich und fast zwingend. Einige andere sind umstritten und haben einen geringeren normativen Gehalt. Wiederum sei auf die eben zitierte Literatur verwiesen.
e) Ist die Bernoulli-Nutzenfunktion u streng monoton wachsend und stetig, so kann das Sicherheitsäquivalent s folgendermaßen dargestellt werden:
s = u – 1 [E u(X)].
f) Als (lokale) Maßzahl für den Grad der Risikoaversion wird im Rahmen des Bernoulli-Prinzips das Arrow-Pratt-Maß
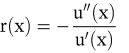
verwendet. Es ist positiv für risikoaverse, negativ für risikofreudige und gleich Null für risikoneutrale Entscheidungsträger. Je größer die Funktion r(x) ist, desto größer ist der Unterschied zwischen E(X) und dem Sicherheitsäquivalent s und damit die als Risikoprämie bezeichnete Differenz E(X) – s. Für risikoneutrale Entscheidungsträger ist die Risikoprämie gleich Null.
g) In den Journalen „ Zeitschrift für Betriebswirtschaft “ und „ Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung “ , neuerdings auch in der „ Betriebswirtschaftlichen Forschung und Praxis “ sowie dem „ OR Spektrum “ , fanden verschiedene Diskussionsrunden statt, wobei es um die Sinnhaftigkeit des Bernoulli-Prinzips, die Interpretation von u und schließlich um den Zusammenhang von u(x) mit den Werten h(x) der (ohne Bezugnahme auf Risikoaspekte) auf den Ergebnissen x definierten kardinal messenden Höhenpräferenzfunktion h ging. Die Kritiker des Bernoulli-Prinzips verfochten den Standpunkt, dass aus logischen Gründen u(x) = h(x) gelten muss. Definiert man die Ergebnisse richtig, d.h. als h(x) und nicht als x, so reduziert sich der Nutzenerwartungswert des Bernoulli-Prinzips auf den schlichten Erwartungswert der (richtig aufgefassten) Ergebnisse. Infolgedessen ist das Bernoulli-Prinzip nicht in der Lage, verschiedene Einstellungen gegenüber dem Risiko zu erfassen. Vielmehr kann es nur Risikoneutralität ausdrücken und ist damit unflexibler als die meisten klassischen Prinzipien. Die „ Kritiker der Kritiker “ wiesen jedoch nach, dass u(x) = h(x) nicht aus logischen Gründen zwingend folgt. Deshalb kann das Bernoulli-Prinzip sehr wohl eine breite Palette unterschiedlicher Einstellungen gegenüber dem Risiko abbilden. (Wegen einer ausführlichen Darstellung dieser Diskussion sei verwiesen auf Kürsten, W. 1992; Dyckhoff, H. 1993; Bamberg, G./Coenenberg, A.G. 2000.)
3. Weitere Entscheidungsprinzipien bei Risiko
Wohl bei jedem Entscheidungsprinzip kann man geeignete Situationen konstruieren, in der die Mehrzahl der Entscheidungsträger gegen das auf dem Prüfstand befindliche Prinzip verstoßen. Auch beim Bernoulli-Prinzip hat es seit der in den frühen 1950er-Jahren von Allais vorgebrachten Kritik nicht an derartigen Versuchen gemangelt (Allais, M. 1953). Diese Experimente gaben oft den Anstoß für alternative Theorien, für die allerdings auch wieder empirische oder theoretische Kritikpunkte gefunden wurden. Relativ bekannt wurden die „ duale Theorie “ sowie die „ rank dependent expected utility “ -Theorie. (Wegen einer ausführlichen Darstellung sei beispielsweise auf Weber, M./Camerer, C. 1987; und Trost, R. 1991 verwiesen.)
III. Entscheidungen bei Ungewissheit
Wenn keine Wahrscheinlichkeiten für die „ Kalkulation des Risikos “ zur Verfügung stehen, bleiben im Wesentlichen nur die beiden Möglichkeiten,
a) die effizienten Aktionen auszusondern und als gleichwertige Lösungen zu offerieren;
b) mittels einer speziellen Entscheidungsregel alle Aktionen in einer Rangfolge zu bringen (und damit auch „ den Spitzenreiter “ zu identifizieren).
Dabei heißt eine Aktion effizient, wenn keine der restlichen Aktionen bzgl. aller Zustände mindestens so gut und bzgl. eines Zustands (oder auch mehrerer Zustände) besser ist als die fragliche Aktion. Es sei wieder das Eingangsbeispiel von Kapitel II betrachtet. Die Aktion a (Kauf von 100 DaimlerChrysler-Aktien) wird nun als a1 bezeichnet. Zusätzlich seien
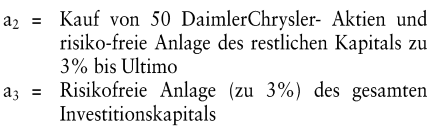
Damit erhält man die Entscheidungsmatrix
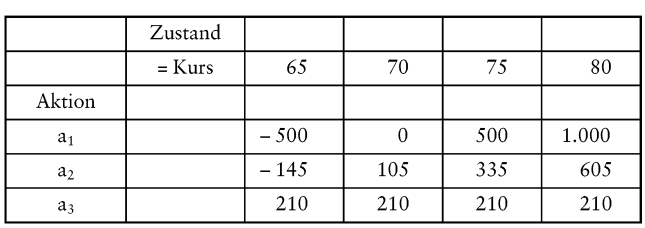
aus der man ersieht, dass alle drei Aktionen effizient sind.
Bezeichnen wir zur Darstellung der exemplarisch betrachteten Entscheidungsregeln die Elemente der Entscheidungsmatrix mit uij, so ist die Maximin-Regel durch die Bewertung
Φ (ai) = min uij
j
definiert, die Maximax-Regel durch
Φ (ai) = max uij,
j
die Hurwicz-Regel mit dem Optimismus-Parameter λ ∊ [0,1] durch
Φ (ai) = λ max uij + (1-λ) min uij,
j j
sowie die Savage-Niehans-Regel durch die (zu minimierende) Bewertungsziffer
Φ (ai) = max (max ukj – uij) .
j k
Eine ausführliche Diskussion des Pro und Contra sowie weitere Regeln sind in der Literatur zu finden (beispielsweise in Bitz, M. 1981; Dinkelbach, W. 1982; Mag, W. 1990; Laux, H. 1998; Homburg, C. 2000; Bamberg, G./Coenenberg, A.G. 2000). Für unser Beispiel ersieht man, dass a1 optimal bzgl. der Maximax-Regel sowie bzgl. der Hurwicz-Regel mit Optimismus-Parameter λ = 0,5 ist. Bezüglich der Savage-Niehans-Regel ist dagegen a2 optimal. Schließlich ist a3 optimal bzgl. der Maximin-Regel.
Literatur:
Allais, M. : Le comportement de l\'homme rationel devant le risque: Critique des postulats et axiomes de l\'école américaine, Econometrica 21, 1953, S. 503 – 546
Bamberg, G. : Statistische Entscheidungstheorie, Würzburg/Wien 1972
Bamberg, G./Coenenberg, A.G. : Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre, 10. A., München 2000
Bitz, M. : Entscheidungstheorie, München 1981
Dinkelbach, W. : Entscheidungsmodelle, Berlin/New York 1982
Dyckhoff, H. : Ordinale versus kardinale Messung beim Bernoulli-Prinzip: Eine Analogiebetrachtung von Risiko- und Zeitpräferenzen, OR Spektrum 15, 1993, S. 139 – 146
Franke, G./Hax, H. : Finanzwirtschaft des Unternehmens und Kapitalmarkt, 4. A., Berlin et al. 1999
Homburg, C. : Quantitative Betriebswirtschaftslehre, 3.A., Wiesbaden 2000
Kofler, E. : Prognosen und Stabilität bei unvollständiger Information, Frankfurt/New York 1989
Kofler, E./Menges, G. : Entscheidungen bei unvollständiger Information, Berlin et al. 1976
Kruschwitz, L. : Finanzierung und Investition, 2. A., München/Wien 1999
Kürsten, W. : Präferenzmessung, Kardinalität und sinnmachende Aussagen, ZfB 62, 1992, S. 459 – 477
Laux, H. : Entscheidungstheorie, 4. A., Berlin et al. 1998
Mag, W. : Grundzüge der Entscheidungstheorie, München 1990
Perridon, L./Steiner, M. : Finanzwirtschaft der Unternehmung, 10. A., München 1999
Schneeweiß, Ch. : Planung I, Berlin et al. 1991
Schneeweiß, Ch. : Planung II, Berlin et al. 1992
Schneeweiß, H. : Entscheidungskriterien bei Risiko, Berlin et al. 1967
Schneider, D. : Investition, Finanzierung und Besteuerung, 7. A., Wiesbaden 1992
Spremann, K. : Wirtschaft, Investition und Finanzierung, 5. A., München/Wien 1996
Trost, R. : Entscheidungen unter Risiko: Bernoulli-Prinzip und duale Theorie, Frankfurt a.M. et al. 1991
Uhlir, H./Steiner, P. : Wertpapieranalyse, 3. A., Berlin/New York 1994
Weber, M. : Ambiguität in Finanz- und Kapitalmärkten, ZfbF 41, 1989, S. 447 – 471
Weber, M./Camerer, C. : Recent Developments in Modelling Preferences under Risk, OR-Spektrum 9, 1987, S. 129 – 151
Wilhelm, J. : Zum Verhältnis von Höhenpräferenz und Risikopräferenz – eine theoretische Analyse, ZfbF 38, 1986, S. 467 – 492
|