|
Gesundheitsstrategien/-management
Inhaltsübersicht
I. Vom Arbeitsschutz zum betrieblichen Gesundheitsmanagement
II. Arbeitsschutz und Prävention
III. Gesundheitsförderung
IV. Betriebliches Gesundheitsmanagement
I. Vom Arbeitsschutz zum betrieblichen Gesundheitsmanagement
Durch die Ottawa-Charter der Weltgesundheitsorganisation, (WHO) von 1986 wurde nicht nur „ Gesundheit für Alle “ zu einem weltweiten Ziel erklärt. Mit Aussagen wie „ Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen “ (www.euro.who.int/About WHO/Policy/20010827_2) wird ein positives Gesundheitsverständnis in den Vordergrund gerückt. Deutlich betont wurde damit, dass zur Stärkung der physischen, psychischen und sozialen Ressourcen sowohl günstige ökologische Voraussetzungen wie auch Kompetenzen notwendig sind, um auf Faktoren, welche die Gesundheit beeinflussen, (selbst) einwirken zu können. Dieses umfassende Konzept der Gesundheitsförderung (WHO Ljubljana Charta zur Reform des Gesundheitswesens 1996) beinhaltet somit die:
| - | gezielte Stärkung gesundheitlicher Ressourcen (Salutogenese), verbunden mit Vermeidung oder Verminderung gesundheitlicher Risiken (Risikofaktorenmodell) und wirkungsvollen Coping-Strategien bei Beschwerden (Bewältigungsmodell), | | - | Befähigung der Bevölkerung, selbst Kontrolle über die Gesundheit auszuüben und sich gesundheitsbewusst zu verhalten (Bindungsmodell, Lebensstilmodell) sowie | | - | Schaffung gesundheitsförderlicher Verhältnisse in Natur (ökologische Modelle) und Gesellschaft. |
Eine so verstandene Gesundheitsförderung geht weit über den klassischen Ansatz der Prävention hinaus. Dieser war vor allem auf Krankheitsverhütung und Verminderung von Risikofaktoren ausgerichtet. Bei der Gesundheitsförderung kommt der Aspekt Förderung individueller gesundheitlicher Ressourcen hinzu. Unter betrieblicher Gesundheitsförderung – einem Vorläufer des heutigen Betrieblichen Gesundheitsmanagements – versteht man die Schaffung gesundheitsförderlicher Strukturen in Unternehmen. Gesundheitsmanagement bedeutet, dass Gesundheitsaspekte grundsätzlich in Personal- und Managemententscheidungen einfließen und zu einer eigenständigen Größe im Zielsystem des Unternehmens werden. Die Entwicklungen vom Arbeitsschutz und Prävention hin zu einem modernen Gesundheitsmanagement sollen im Folgenden erläutert werden.
II. Arbeitsschutz und Prävention
Prävention hat sich in der Arbeitswelt unter den Begriffen „ Arbeitsschutz “ und „ Arbeitsmedizin “ seit langem etabliert und ist in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen vom Gesetzgeber gefordert (Griefahn, 1998). Arbeitsschutz bezeichnet ein umfassendes Konzept zum Schutze der Beschäftigten vor gesundheitsgefährdenden Belastungen am Arbeitsplatz. Ziel des Arbeitsschutzes ist es, durch geeignete Präventivmaßnahmen Unfallgefahren und langfristig pathogen wirkende Beanspruchungen am Arbeitsplatz zu reduzieren.
Grundlagen des Arbeitsschutzes sind Belastungs-Beanspruchungs-Modelle. Mit deren Hilfe wird eine Harmonisierung zwischen Mensch und Arbeit gesucht. Im Vordergrund stehen die Anpassung der Arbeit an den Menschen durch funktionsgerechte, ergonomische Gestaltung von Maschinen, Arbeitsmitteln, Arbeitsräumen und der Arbeitsorganisation. Diese Maßnahmen haben Vorrang vor dem medizinischen Arbeitsschutz, dessen Ziel die Anpassung des Menschen an die Arbeit ist (z.B. durch gezielte Ausbildung und Training, Personalselektion oder Vorsorgeuntersuchungen; Arbeitsmedizin).
Der Gesetzgeber versucht, mittels geeigneter Maßnahmen spezielle Risiken wie schädliche Umwelteinwirkungen (Immissionsschutzgesetz (BlumschG), Strahlenschutzverordnung (StrSchv), Röntgenschutzverordnung (RÖV)) und gefährliche Stoffe (Chemikaliengesetz (ChemG)) oder unsichere Geräte (Gerätesicherheitsgesetz (GSG)) zu reduzieren und so die Allgemeinheit, aber auch die Erwerbstätigen zu schützen. Weitere spezielle Schutzbestimmungen gelten für die Erwerbstätigen (Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Sozialgesetzbuch VII (SGB), Arbeitszeitgesetz (ArbZG), Gewerbeordnung (GewO)). Geschützt werden seit langem schon besondere Arbeitnehmergruppen wie Jugendliche, Mütter, Frauen und Behinderte (Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Mutterschutzgesetz (MuSchG), Schwerbehindertengesetz (SchwbG) (Griefahn, 1998; Arbeitsschutzrecht).
Der Vollzug der Arbeitsschutzbestimmungen liegt bei den Unternehmern. Staatliche und öffentlich-rechtliche Institutionen sind an der Beratung der Unternehmen und an der Überwachung der Umsetzung beteiligt. Die Unternehmen in Deutschland müssen für die Durchführung des technischen und medizinischen Arbeitsschutzes, mit Zustimmung des Betriebsrates, Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte einstellen sowie einen Arbeitsschutzausschuss bilden. Die Gewerbeaufsichtsämter beraten und kontrollieren die Umsetzung der Vorschriften zum technischen Arbeitsschutz. Ähnliche Aufgaben und Kompetenzen haben auch die gewerblichen und landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften. Staatliche (bzw. Landes-) Gewerbeärzte beraten und überwachen den medizinischen Arbeitsschutz.
Die Ansätze des Arbeitsschutzes lassen sich auf die oft problematischen Arbeitsbedingungen zu Beginn der Industriegesellschaft zurückführen. In den vergangenen fünf Jahrzehnten hat sich in der Arbeitswelt jedoch ein deutlicher Belastungsstrukturwandel ergeben (Griefahn, 1998). Die direkte körperliche Schädigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hat an Gewicht verloren, jene der psychischen und sozialen Beeinträchtigungen und deren somatischen Folgen jedoch zugenommen. Allerdings ist es nicht so, dass die körperlichen Belastungen heute bedeutungslos wären. Hinzu gekommen sind jedoch Veränderungen auf Grund technischer Neuerungen, zunehmendem Termindruck und ein Mehr an Stress und Hektik. Geändert haben sich sicher auch die Einstellungen gegenüber Arbeit, Beruf, Karriere, Familie und Freizeit. Aufgrund dieses Wertewandels hat die Arbeit als zentraler Wert für die Bedürfnisbefriedigung verloren. Immaterielle und geistige Ansprüche an die Arbeit wie Sinnstiftungen, persönliche Entfaltung, Partizipation, Anerkennung etc. hingegen sind bedeutend wichtiger geworden. Bei diesen Aspekten versagen die klassischen Belastungs-Beanspruchungs-Modelle und Präventionsansätze. Gesundheitsförderung nach dem Verständnis der WHO versucht dieser neuen Situation gerecht zu werden. Gesundheitsförderung setzt bei der Analyse und Stärkung von Gesundheitsressourcen und -potenzialen an. Sie umfasst Maßnahmen, die auf Veränderung und Förderung des individuellen und kollektiven Gesundheitsverhaltens sowie der Lebens- und Arbeitsverhältnisse abzielen. Wesentlich dabei ist, dass die Frage im Zentrum steht „ Wie und wo wird Gesundheit hergestellt? “
III. Gesundheitsförderung
Gesundheitsförderung geht von folgenden Leitvorstellungen aus (Hurrelmann, 2000):
| - | Gesundheit ist die gelungene, Krankheit die nicht gelungene Bewältigung von inneren und äußeren Anforderungen. | | - | Gesundheit ist das Stadium des Gleichgewichtes von Risiko- und Schutzfaktoren auf körperlicher, psychischer und sozialer Ebene. | | - | Es existieren Stadien von relativer Gesundheit und relativer Krankheit, wobei objektive und subjektive Kriterien in die Definition eingehen. | | - | Gesundheit und Krankheit sind auch Reaktionen auf gesellschaftliche Gegebenheiten, insbesondere im wirtschaftlichen, ökologischen und bildungsbezogenen Bereich. |
Gesundheitsförderung muss neben den primär- (Vermeidung exogener Schädigungen), sekundär- (Früherkennung) und tertiärpräventiven (Vermeiden bzw. Mildern von Folgeschäden) Präventionsstrategien auch die Kompetenzen der Individuen und Organisationen verbessern, um die Selbstorganisation des Gesundheitsverhaltens und die Gestaltung gesundheitsrelevanter Umweltbedingungen zu ermöglichen. Eine wesentliche Strategie ist dabei die Stärkung der individuellen Kompetenzen durch Gesundheitserziehung bzw. -bildung. Diese umfassen alle Strategien, die der Stärkung der Persönlichkeit durch Wissen und Kompetenzvermittlung im Zusammenhang mit Gesundheitsverhalten und gesundheitsrelevanten Umweltbedingungen stehen.
In den 1970er-Jahren entstanden Konzepte der Gesundheitserziehung, die darauf ausgerichtet waren, Menschen bewusst und zielorientiert zu bestimmten Verhaltensweisen zu führen. Dazu gehörten insbesondere die Vermeidung von gesundheitsgefährdendem Verhalten, schlechte Körperpflege, Fehlernährung, Bewegungsmangel, Suchtmittelmissbrauch usw. Diese Anstrengungen dieser Gesundheitserziehung können wegen ihrer traditionellen Orientierung an der Autorität wissenschaftlicher Erkenntnisse als autoritativ bezeichnet werden.
Seit den 1980er-Jahren wird diese Konzeption der Gesundheitserziehung zunehmend kritisiert. Insbesondere die Ausrichtung auf einfache Risikomodelle und auf Indivduen erwies sich als unzureichend und didaktisch problematisch. An ihre Stelle tritt das Konzept einer partizipativen Gesundheitserziehung. Im Unterschied zum autoritativen Konzept geht es nicht darum, bestimmte Verhaltensänderungen einzuüben, um Krankheiten vorzubeugen, sondern um die Suche nach einer Balance von Gesundheit und Krankheit. Grundlagen sind umfassende Konzepte der Stress- und Bewältigungstheorie und der Sozialisationstheorie. Typisch ist auch, dass nicht auf die Krankheitsymptome bzw. auf gesundheitliche Risiken abgestellt wird, sondern auf deren Ursachen und Ausgangspunkte. Beispiele einer partizipativen Gesundheitserziehung sind etwa „ soziale Immunisierung “ oder der „ Live-Skill-Ansatz “ (Hurrelmann, 2000). Bei der sozialen Immunisierung geht es darum, konkrete Verhaltensempfehlungen zu vermitteln, um beispielsweise Gegenstrategien auf den Druck von Peer-Groups zu gesundheitsschädigendem Verhalten (z.B. Alkohol- oder Tabakkonsum) entwickeln zu können. Der Live-Skill-Ansatz konzentriert sich auf die Entwicklung von Bewältigungskompetenzen, die über den Gesundheitsbereich hinaus von Bedeutung sind, d.h. insbesondere um persönliche und soziale Kompetenz zur Auseinandersetzung von Alltagsanforderungen. Damit wird Gesundheitsbildung zu einer Intervention zur Stärkung der Kompetenzen, um zu einer gesundheitlichen Selbststeuerung zu gelangen. Gesundheitsförderung wird daher in mehreren Ländern auf verschiedenen Schulstufen als Unterrichtsfach verankert.
Weitere Strategien gehen in die Richtung „ Stärkung der Kompetenz zur Krankheitsbewältigung “ , z.B. im Rahmen von Patientenschulungen. In der Praxis sind diese Maßnahmen vor allem bei chronischen Erkrankungen erfolgreich. Über neue Kommunikationsmedien können sich Patienten heute sehr gezielt informieren und damit zu einer Stärkung ihrer Kompetenz in der Beziehung zu den Health Professionals beitragen.
Die Entwicklung der Gesundheitsförderung wurde durch verschiedene Faktoren unterstützt. Einerseits hatte die in den 1970er-Jahren erfolgte Kritik am vorherrschenden bio-medizinischen Paradigma der Schulmedizin zur Folge, dass nach ganzheitlichen Konzepten für die Betrachtung von Krankheit und Gesundheit gesucht wurde. Ergebnisse großer Präventionsstudien in den 1970er- und 80er-Jahren haben vor allem im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu einem Überdenken der Präventionsansätze geführt. Auch tragen die unterschiedlich ausgeprägten Fitness- und Wellness-Bewegungen auf breiter Basis zu einem verstärkten Gesundheitsbewusstsein bei.
Maßgeblich für die methodische Weiterentwicklung der Gesundheitsförderung war auch der Setting-Ansatz (Brößkamp-Stone, /Kickbusch, /Walter, 1998, S. 145 f.). Dieser ist seit 1985 eine Kernstrategie in den meisten WHO-Programmen. Er baut darauf auf, dass gesundheitsfördernde Maßnahmen immer auf konkrete Lebensbereiche ausgerichtet sind, in welchen die Menschen große Teile ihrer Zeit verbringen und die von ihrer Struktur her die Gesundheit maßgeblich beeinflussen. Die WHO hat in den letzten zehn Jahren zahlreiche Netzwerke nach dem Setting-Ansatz initiiert, so u.a. gesundheitsfördernde Städte, gesundheitsfördernde Krankenhäuser, gesundheitsfördernde Universitäten oder auch gesundheitsfördernde Unternehmen.
IV. Betriebliches Gesundheitsmanagement
Nach der Schule verbringen die meisten Erwachsenen einen Großteil ihrer Zeit an ihrem Arbeitsplatz. Diese sozialen Beziehungen und die sozialen Strukturen in den Unternehmen bilden eine ideale Voraussetzung, um Gesundheitsförderung bei Erwachsenen anzugehen. Der Arbeitsplatz ist zudem ein viel konkreteres Sozialgefüge als etwa die Kommune, die heute sehr häufig nur noch abstrakt und in einem lockeren Bezug wahrgenommen wird. Unternehmen sind daher ideal für Gesundheitsbildung und Gesundheitsförderung (Grossmann, /Scala, 1994). Soziale Organisationen haben feste Mitglieder, formale und informelle Strukturen und gemeinsame Werte. Mit ihren damit reglementierten Erwartungen und Normen üben sie einen großen Einfluss auf das Verhalten der Mitglieder aus. Diese unterwerfen sich bis zu einem gewissen Grad Organisationszielen und sind meist auch durch Arbeitsverträge zu bestimmten Verhaltensweisen verpflichtet. Unternehmen sind aber auch nicht starr, sondern befinden sich in einer ständigen Veränderung. Mit Bezug auf die Gesundheitsförderung zeigt sich, dass dieses in diesen Veränderungsprozessen nur Bestand haben kann, wenn Gesundheit einen festen Platz im Zielsystem der Unternehmung hat.
Auch wenn im Management von Unternehmungen Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis vor Kurzem kaum über das Maß des Arbeitsschutzes hinaus thematisiert worden ist, so zeichnet sich heute eine deutliche Wende ab. Gesundheit als Organisationsprinzip in Unternehmungen aufzunehmen ist kein Widerspruch zu den traditionellen Organisationszielen, da der Wert der Beschäftigten heute anders eingeschätzt (Human-Kapital) wird als noch vor wenigen Jahren.
Heute ist man sich im Management der Zusammenhänge zwischen Arbeitsverhalten (wie Leistungsbereitschaft, Flexibilität und Innovationskraft) der Menschen und deren Gesundheitszustand, körperlicher Gesundheit und seelischem Wohlbefinden sowie der Arbeitsinhalte, Arbeitsgestaltung und der Belastungen durchaus bewusst (vgl. Abb.1). In vielen Settings sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einer wichtigen Ressource geworden. Dies nicht nur wegen der zunehmend teuren und spezialisierten Aus- und Weiterbildung, sondern auch wegen den für die Leistungserfüllung wichtigen Erfahrungen und Skills. Gerade im Zusammenhang mit Wissensmanagement und der Konzeption der lernenden Organisation steigt die Bedeutung der Mitarbeiter. Sie vollziehen nicht nur Aufgaben im Produktionsprozess, sondern sind viel mehr tragendes Element der Entwicklungsprozesse in der Unternehmung.
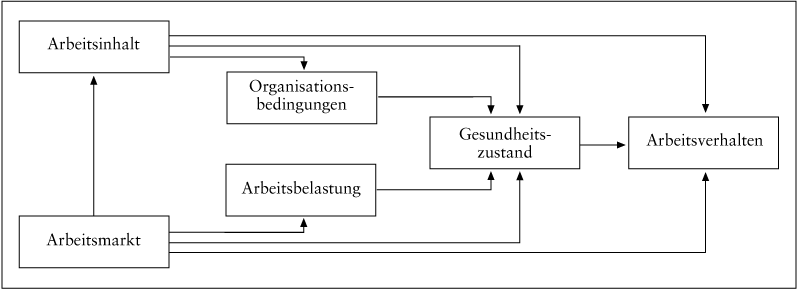
Abb. 1: Zusammenhänge zwischen Rahmenbedingungen, Arbeitsorganisation, Gesundheit und Arbeitsverhalten (nach Schroda, /Ishig, /Riemer, et al. 2001; Badura, /Ritter, /Scherf, 1999).
Eine erweiterte Bedeutung kommt den Mitarbeitern – auch jenen auf „ unterer Hierarchiestufe “ – in Dienstleistungsunternehmen zu. Zumindest bei personalen Dienstleistungen spielen neben dem Fachwissen und der Erfahrung auch weitere Fähigkeiten, etwa das Kommunikations- und Sozialverhalten, eine entscheidende Rolle, fallen doch Produktion und Marketing der Leistung zusammen. Gerade Kommunikation und damit auch die Qualität der Leistung werden aber direkt durch Gesundheit und Wohlbefinden beeinflusst. Indirekt spielt auch die erlebte Wertschätzung der Mitarbeiter durch die Unternehmensleitung eine große Rolle. Pflege und Förderung dieser wichtigsten Ressource im Prozess der Leistungserstellung erhalten somit einen hohen Stellenwert – wie etwa verschiedene Anstrengungen im Bereich von Krankenhäusern (vgl. u.a. Pfaff, 2004) und Heimen (vgl. u.a. Wolke, 2004) zeigen – und müssen sich sowohl auf der normativen wie auch der strategischen und operativen Ebene des Managements von Organisationen wiederfinden (vgl. Abb. 2).
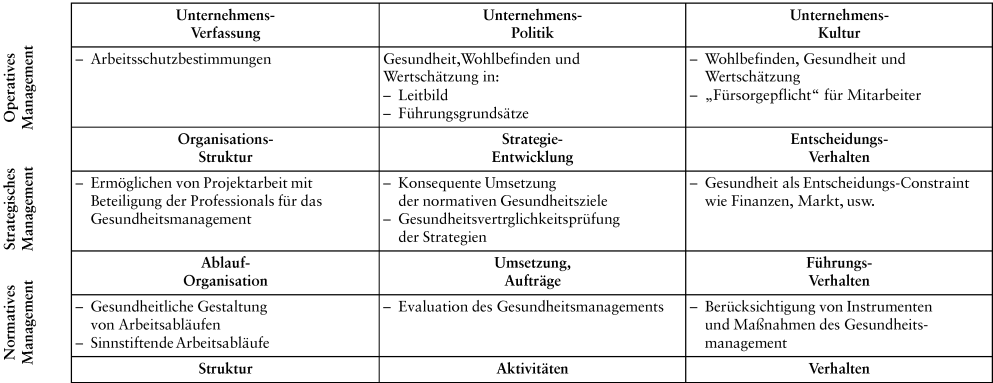
Abb. 2: Das „ St. Galler Gesundheits-Management-Konzept “ (nach Bleicher, 1999).
Die in der Literatur zusammengetragenen Erfolgsfaktoren für das betriebliche Gesundheitsmanagement (vgl. u.a. Badura, 2000) zeigen, dass Förderung der Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein integraler Bestandteil des Leitbildes und der Führungsgrundsätze sein muss. Diese Selbstverpflichtung beeinflusst in der Regel auch die Unternehmenskultur und damit den Umgang mit Wohlbefinden und Gesundheit, aber auch mit Kommunikation, Sozialverhalten sowie das Betriebsklima. Die normative Vorgabe, Gesundheit und Wohlbefinden im Betrieb zu fördern, muss auf der strategischen und operativen Managementebene umgesetzt werden. Bei strategischen Entscheidungen müssen Gesundheitsaspekte (z.B. Gesundheitsverträglichkeitsprüfung) ebenso berücksichtigt werden wie etwa die finanziellen oder Marktaspekte. Die Organisationsstrukturen müssen Vernetzung zulassen. Gesundheitsmanagement ist eine komplexe Aufgabenstellung, die ein interdisziplinäres Vorgehen in Teamarbeit und Projektgruppen erfordert. Experten des betriebsärztlichen Dienstes, der Sicherheitsabteilung, aber auch der sozialen Dienste sowie der Personal- und Organisationsentwicklung müssen in Projektgruppen und Qualitätszirkeln vertreten sein. Im Entscheidungsverhalten sind Gesundheitsaspekte wie andere Constraints zu behandeln. Auf der operativen Managementebene geht es darum, konkrete Arbeitsabläufe nicht nur entsprechend den Bestimmungen des Arbeitsschutzes, sondern auch unter Berücksichtigung der Sinngebung zu gestalten. Das Führungsverhalten auf allen Ebenen muss ein glaubwürdiges Interesse an Zielen und Maßnahmen des Gesundheitsmanagements entwickeln und dessen Evaluation unterstützen. Die Bedeutung der Führung wird auch in der neuesten Diskussion um den Einfluss des Sozialkapitals auf die Gesundheit (vgl. u.a. Badura, 2005) deutlich. Ein hohes Niveau an Sozialkapital bedeutet Vertrauen, gegenseitige Unterstützung, Kommunikation und soziale Kontakte, Arbeitszufriedenheit und psychisches Wohlbefinden. Damit werden nicht nur psychische Belastungen abgebaut, sondern auch gesundheitsschädliches Verhalten (Suchtverhalten) reduziert.
Maßgebend für ein erfolgreiches betriebliches Gesundheitsmanagement ist, dass es nicht als Reparaturmaßnahme verstanden und auch nicht als ein zeitlich begrenztes Projekt betrieben wird. Erfolgreich wird es erst, wenn es dauerhaft institutionalisiert, fest in der normativen Ebene und in der Unternehmenskultur verankert und als Lernzyklus (vgl. Abb. 3) ausgestaltet wird.
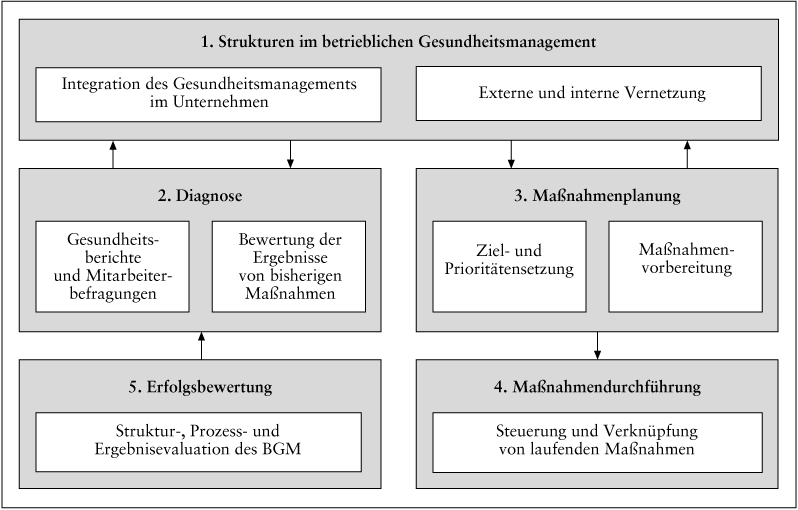
Abb. 3: Gesundheitsmanagement als Lernzyklus (nach Badura, /Ritter, /Scherf, 1999).
Die Bedeutung des Gesundheitsmanagements wird heute sowohl von gewerkschaftlicher wie auch von unternehmerischer Seite zunehmend erkannt. Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung aber auch die Bertelsmann-Stiftung (vgl. u.a. Badura, /Ritter, /Scherf, 1999; Badura, 2000) haben wichtige Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet unterstützt und Erfahrungen systematisch zusammentragen lassen. Aber auch Krankenversicherungen sind an der Thematik immer stärker interessiert, beteiligen sich an Forschungsprojekten (vgl. u.a. Kreis, /Bödeker, 2004, Barmer, 2004) und bieten entsprechende Leistungs- und Beratungsangebote an. Dies sicher auch, weil inzwischen die ökonomische Evidenz des betrieblichen Gesundheitsmanagements bewiesen ist (vgl. u.a. WIG, 2004).Damit wird die Diskussion gefördert und die Einführung erleichtert. Im Rahmen dieser Projekte ist entlang des Lernzyklus (vgl. Abb. 3) ein Instrument zur Selbstbewertung der Unternehmung hinsichtlich des Standes des Gesundheitsmanagements ausgearbeitet (Badura, /Ritter, /Scherf, 1999). Dieses kann auch für die Evaluation und periodische Überprüfung verwendet werden. Zur Überprüfung des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist jedoch auch der Aufbau einer betrieblichen Gesundheitsberichterstattung notwendig. Dieses muss über eine detaillierte Fehlzeitenanalyse hinausgehen (Lierse, 1999) und neben biopsychosozialen Kennziffern zu Salutogenese und Pathogenese (Zielgrößen) zur Ressourcen- und Belastungssituation (Einflussgrößen) (Pfaff, 1999; Siewerts, /Badura, 2004) auch organisationsdiagnostische Indikatoren umfassen. Diese Indikatoren können für neue Konzepte der betrieblichen Berichterstattung (z.B. Balanced Scorecard, (vgl. u.a. Ackermann, 2000)) bzw. des Qualitätsmanagements (z.B. EFQM-Modell) ohnehin schon verwendet werden.
Die Mitarbeiterperspektive lässt sich im Ansatz der Balanced Scorecard mit gesundheitsrelevanten Kennzahlen wie Investitionen in Arbeitsschutz-, Gesundheitsbildungsmaßnahmen wie Mitarbeiterzufriedenheit, Fehlzeiten aufgrund von Krankheit, prozentualer Anteil Versetzungsanträge u.a. einsetzen. Ähnliches kann mit dem EFQM-Ansatz realisiert werden, enthält das Modell doch in den Kriterien 2 „ Mitarbeiter “ , 5 „ Prozesse “ , 6 „ mitarbeiterbezogene Ergebnisse “ und 9 „ Schlüsselergebnisse “ die Mitarbeiterbelange (vgl. u.a. Brandt, 2001). Mit Hilfe derartiger Indikatoren sind Gesundheitszustände von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern messbar und können über Zeiträume dokumentiert und evaluiert werden. Nach zielgerechter Intervention des betrieblichen Gesundheitsmanagement sind damit Veränderungen in der Organisation diagnostizierbar.
Literatur:
Ackermann, K.-F. : Balanced Scorecard für Personalmanagement und Personalführung, Stuttgart 2000
Badura, B. : Einleitung, in: Erfolgreich durch Gesundheitsmanagement, hrsg. v. Bertelsmann Stiftung, /Hans-Böckler-Stiftung, , Gütersloh 2000
Badura, B. : Social Capital, Economic Performance and Health, in: Sprenger, M. (Hrsg.): Public Health in Österreich und Europa, Lengerich 2005, S. 145 – 150
Badura, B./Kickbusch, I. : Health promotion research, Copenhagen et al. 1991
Badura, B./Ritter, W./Scherf, M. : Betriebliches Gesundheitsmanagement, Düsseldorf 1999
Barmer, : Gesundheitsreport 2004, Wuppertal 2004
Bleicher, K. : Das Konzept Integriertes Management, Frankfurt/Main 1999
Brandt, E. : Qualitätsmanagement & Gesundheitsförderung im Krankenhaus, Luchterhand 2001
Brößkamp-Stone, U./Kickbusch, I./Walter, U. : Gesundheitsförderung, in: Das Public Health Buch, hrsg. v. Schwartz, W., München 1998, S. 141 – 150
Griefahn, B. : Arbeitswelt und Gesundheit, in: Handbuch Gesundheitswissenschaften, hrsg. v. Hurrelmann, K./Laaser, U., Weinheim et al. 1998, S. 443 – 466
Grossmann, R./Scala, K. : Gesundheit durch Projekte fördern, Weinheim et al. 1994
Hurrelmann, K. : Gesundheitssoziologie, Grundlagentexte Soziologie, Weinheim et al. 2000
Kreis, J./Bödecker, W. : Indicators for work-related health monitoring in Europe, BKK Bundesverband, Essen 2004
Lierse, M. : Betriebliche Fehlzeiten, in: Betriebliches Gesundheitsmanagement, hrsg. v. Badura, B. et al., Berlin 1999, S. 140 – 144
Pfaff, H. : Organisationsdiagnose im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, in: Betriebliches Gesundheitsmanagement, hrsg. v. Badura, B. et al., Düsseldorf 1999, S. 135 – 139
Pfaff, H. : „ Weiche “ Kennzahlen für das strategische Krankenhausmanagement, Bern 2004
Schroda, F./Ishig, A./Riemer, S. : Erschließung arbeitsinhaltlicher und organisatorischer Ressourcen zur gesundheitsförderlichen Gestaltung von Arbeitsprozessen, in: Zeitschrift für Gesundheitswissenschaften, H. 2/2000, S. 126 – 143
Siewerts, D./Badura, B. : Gesundheitsmanagement als Beispiel für die Anwendung von biopsychosozialen Kennzahlen, in: Pfaff, et al. (Hrsg.): „ Weiche “ Kennzahlen für das strategische Krankenhausmanagement, Bern 2004, S. 187 – 208
WIG, : Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie: Ökonomische Beurteilung von Gesundheitsförderung und Prävention, Winterthur 2004
Wolke, R. : Gesündere und leistungsfähigere Mitarbeiter in der Pflege, Lage 2004
|